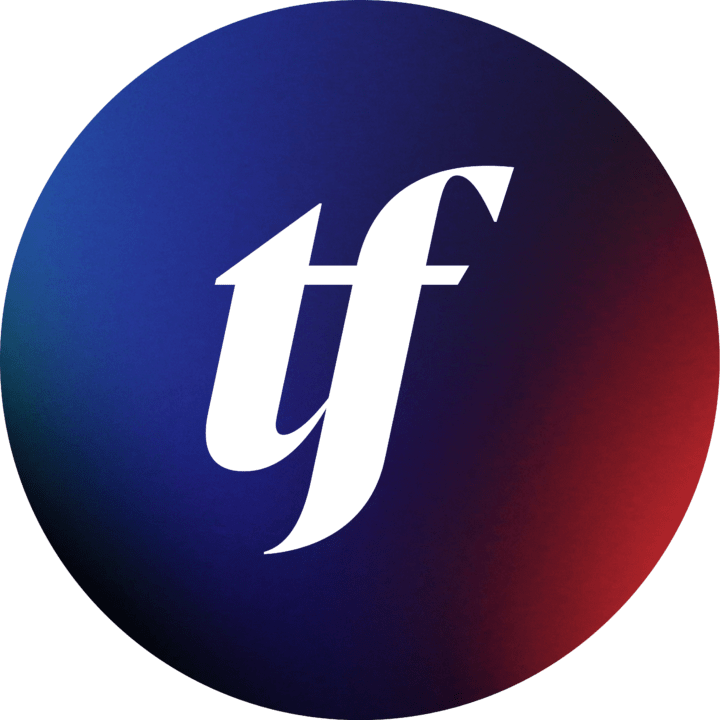Machen Verzicht und Nachhaltigkeit aus uns bessere Menschen? Oder sind es nur Konsumoptionen, die uns zur Abgrenzung und Aufwertung dienen?
Zum ersten Mal hörte ich das Wort “Nachhaltigkeit” als englisches “sustainability” vor vielleicht 17 Jahren in einem feuchten Rohbau. Dort, im äußersten Westzipfel Großbritanniens, scheuchte der englische Wind ein paar traurige Plastikplanen vor den leeren Fensterhöhlen hin und her. Drinnen saßen wir – gut zwei Dutzend Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und unserem englischen Austauschprogramm.
Vor ein paar Tagen erst waren wir ökologisch sauber aus Mitteldeutschland angereist, die Fahrt im Bus hatte über 24 Stunden gedauert. Es war kalt, klamm und totmüde bestaunten wir unsere englischen Klassenkameraden, die schon zum Frühstück Chips in kleinen Tüten aßen. Ihre Schule wurde gerade “nachhaltig” saniert, aber für uns war es schlichtweg eine surreale Zumutung.
Irgendwie passte das damals aber perfekt in das etwas belächelte Image von “Nachhaltigkeit”. Vielen galt sie lange synonym mit Öko-Kirchenbasaren oder muffigen Eine-Welt-Läden – irgendwas zwischen importierter Exotik, kitschigem Fernweh, Selbstgebasteltem und Biofuzzi-Spinnerei. Ich bin in den 90er Jahren im Osten Deutschlands aufgewachsen, für uns waren die großen Einkaufscenter draußen vor der Stadt wahre Magneten. Dort gab es mehr von allem – mehr Auswahl, mehr Dinge, noch billigere Preise. Für irgendeine Sache mehr zu bezahlen oder länger danach zu suchen, weil es “fairer” wäre, klang zu der Zeit geradezu absurd.
Diese Zeiten sind längst vorbei. Nachhaltigkeit ist heute Statussymbol und Instagram-Hashtag zugleich. Rund um das Thema “Nachhaltigkeit” ist mittlerweile eine ganze Industrie erwachsen. Dutzende von Siegeln buhlen beim Einkauf darum, mein verknittertes Konsumgewissen glattzubügeln, denn ethische und ökologisch durchdachte Produkte und Dienstleistungen sind ein Profitgeschäft. “Greenwashing” nennt sich das im schlimmsten Fall, also die Auszeichnung von Produkten und Dienstleistungen nach sehr geringen oder selbst erfundenen Standards, die im Grunde nur das eigene Gewissen erleichtern. Dabei frage ich mich: Ist Nachhaltigkeit im Alltag heute mehr als nur Konsumentscheidung – ist sie auch politisches Statement?
To be or not to be nachhaltig

Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir Nachhaltigkeit meinen? Als “Erfinder“ der Nachhaltigkeit gilt heute der aus dem Erzgebirge stammende Hans Carl von Carlowitz, der den Begriff 1713 in seinem Werk Silvicultura oeconomica beschrieb. Von Carlowitz plädierte für eine Forstwirtschaft, die nur so viele Holzressourcen nutzt, wie nachwachsen können, denn Holz war ein essentieller Rohstoff zum Heizen, Bauen und für den Bergbau. Ähnliche Ansätze hatten bereits toskanische Mönche um 1350 ausprobiert.
Seine moderne Prägung erlangte der Begriff Nachhaltigkeit in den 1980ern durch den so genannten Brundtland-Report der UN, in dem es unter anderem heißt: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ Darauf aufbauend verstehen wir heute Nachhaltigkeit in der Regel als zukunftsorientierte Erneuerung beziehungsweise Erhaltung von ökologischen, wirtschaftlichen und menschlichen Ressourcen.
Anfang des Jahres 2017 wollte ich dies für mich selbst ausprobieren und begann daher, für eine Woche eine Nachhaltigkeits-Tagebuch zu führen. Für meine WG notiere ich damals eine erste Positivbilanz: Wir essen vegetarisch oder vegan, Textilien, Möbel sowie Elektronik kaufen wir überwiegend Second Hand und vermeiden so, dass neue Güter produziert werden. Wir beziehen Ökostrom und recyceln zur Belustigung ausländischer Freunde „very German“ in sechs Mülleimern.
Ein Auto hat keiner von uns, wir fuhren damals acht Monate im Jahr mit dem Rad und zuletzt privat mit dem Flugzeug verreist bin ich 2011. Doch auch dieser bescheidene Öko-Lifestyle hat schnell ein paar Kratzer: So sind meine Zigaretten geradezu das Gegenteil von nachhaltig und während des Winterschlussverkaufs landet ein T-Shirt für drei Euro in meinem Schrank. Die schwedische Modekette verspricht zwar „nachhaltige Baumwolle“ – aber was kommt bei diesem Preis noch beim Produzenten an? Auch andere Lebensbereiche sind problematisch – so erfahre ich auf der Seite slaveryfootprint.org, dass mein Konsumverhalten 25 Menschen in moderne Sklaverei zwingt.
Immerhin 15 weniger als der Durchschnitt, aber einfach 25 Menschen zu viel. Die Gründe: mein neues Smartphone sowie Kosmetik mit dem Konfliktmineral Mica. Die Rohstoffe dafür werden bekanntermaßen durch den Einsatz von Kinderarbeit gefördert.
Konsum als Erleichterung und Vergnügen
Noch komplizierter wird es, wenn die eigenen Überlegungen zu Nachhaltigkeit andere Menschen tangiert. Das mag in gewissem Rahmen bei Familie und Freunden noch machbar sein. Im Job habe ich hierbei schnell Grenzen erlebt – statt Skype-Meeting oder Bahnfahrt flogen Mitarbeiter nach London und Paris, statt Kantine gab es Fast Food.
Die unbequemste Wahrheit war jedoch, zu bemerken, dass ich selbst gerne konsumiere. Oft schon, weil ich weder die Zeit, Geduld oder Kenntnisse habe, alles, was ich zum Leben brauche, selbst herzustellen. Für mich wie für viele andere ist Konsum Erleichterung und Vergnügen im Alltag.
Dennoch sollte Konsum niemandem schaden. Mein Kompromiss war und ist seit einigen Jahren, dass ich beim Einkaufen auf Siegel für fairen oder biologischen Handel achte. Damit stehe ich nicht alleine da: Ethisch vertretbare Produkte werden allein in Deutschland immer beliebter.
Laut der letzten Erhebung 2014 wurden hierzulande faire Waren im Wert von 827 Millionen Euro gekauft, das waren 173 Millionen mehr als 2013. Es gibt in Deutschland 26 faire Siegel, das bekannteste davon ist Fairtrade, das 2014 laut Forum Fairer Handel 78 Prozent der Sparte “Fairer Handel” abdeckte. Aber reicht es, einfach loszukaufen und dabei Gutes tun?
Muss nur noch mal schnell die Welt retten
Das Siegel Fairtrade interpretiert genauso wie seine Konkurrenz-Siegel den ungeschützten Begriff “fair“ nach eigenen Kriterien. Beispielsweise müssen so genannte Mischprodukte wie Schokolade einen Mindestanteil von 20 Prozent an fairen Zutaten enthalten, um das begehrte Label zu erhalten. Der Rest der Zutaten kann völlig “unfair“ sein. Auch auf Produkte aus verschiedenen Ernten wie Saft, Tee oder Zucker wird dieser sogenannte Mengenausgleich angewandt. Dadurch kann es passieren, dass ein Produkt das Fairtrade-Siegel erhält, ohne faire Ware zu enthalten. Ein Eiscreme-Hersteller ging zudem so weit, mit großen Fairtrade-Aufmacher auf Bechern und Homepage zu werben. Die 20 Prozent Mindestanteil in einigen seiner Sorten zu wurden dabei aber sogar unterschritten – bisher ohne Konsequenzen.
Wie kann so etwas passieren? Es liegt an unserem Hunger nach fairen Waren, die wir ohne allzu schlechtes Gewissen konsumieren und uns auch damit ein wenig vom Durchschnitt abheben wollen. Es liegt aber auch an unserer Überforderung, etliche Labels zu studieren und zu vergleichen. Deshalb boomt der Markt mit fair gehandelten Gütern, dessen Umsatz sich von 2011 bis 2014 verdoppelte.
Auch im Discounter finden sich nun von Fairness und Nachhaltigkeit inspirierte Labels wie UTZ, Fairglobe oder Rainforest Alliance. Sie gelten laut Stiftung Warentest jedoch als eher schwache Siegel. Gelobt wurde von der Stiftung hingegen die Kennzeichnung Gepa Plus, bei der mindestens 50 Prozent der Zutaten fair gehandelt sein müssen. Trotz aller Unstimmigkeiten und Unterschiede empfehlen viele Experten den Kauf gekennzeichneter Produkte, denn selbst wer auch nur auf niedrige ökologische wie soziale Standards achtet, macht es immer noch besser, als diese gar nicht zu haben.
Zwischen Abfallberg und Zero Waste

Eine noch größere und alltägliche Herausforderung als der reine Konsum stellt mittlerweile der wachsende Müllberg dar, zu dem selbst der fairste Einkauf noch etwas beiträgt. Gerade in Deutschland aber wähnt man sich noch immer als fortschrittlich, lange galt das Land als Recycling-Weltmeister. Hier wurde Anfang der 1990er erfolgreich das Duale System sowie den „Grünen Punkt“ entwikelt, zwei starke Ideen, die heute weltweit verbreitet sind. Tatsächlich verursachten aber laut Eurostat die Menschen in Deutschland selbst 2013 pro Kopf 617 Kilogramm Haushalts- und Verpackungsabfälle und damit 136 Kilogramm mehr als der EU-Durchschnitt.
Die Hauptgründe dafür sind vor allem die starke Zunahme von Verpackungsmüll aus dem Online-Handel, Convenience-Produkte wie Kapseln für Kaffeeautomaten und Pappbecher der To-Go-Kultur, aber auch die Schwemme an Billigtextilien. Ebenso sind Elektrogeräte ein Problem, deren Hard- oder Software nur von kurzer Lebensdauer sind und sich durch so genannte geplante Obsoleszenz nicht reparieren lassen. Auch die gute alte Mülltrennung ist für viele passé – viele haben „keine Lust” mehr auf zig Mülleimer in der Wohnung. Ihr Hauptargument: Es kommt doch am Schluss eh alles in eine Tonne.”
Auch dafür gibt es aber passende Trends – sie nennen sich Minimalismus und Zero-Waste-Bewegung. Beiden gelingt es, Nachhaltigkeit mit einem reduziert-eleganten Lifestyle zum kombinieren. Auffällig häufig sind es dabei weiße Frauen aus der Mittelschicht wie die Französin Bea Johnson oder die US-Amerikanerin Lauren Singer, die den Ton in der Zero-Waste-Szene angeben. Ihr Markenzeichen: ein Schraubglas, in das ihr gesamter Jahresmüll passt und das sich in zahlreichen Clips auf YouTube bewundern lässt.
Statt Klamotten-Hauls oder Schminktipps präsentieren beide Youtuberinnen Alternativen ohne Verpackung oder Ideen, wie sich Alltags-Produkte nachhaltig ersetzen lassen. Zu ihren Tipps gehören unter anderem selbstgemachtes Deo, Waschmittel oder Plastikvermeidung beim Einkaufen. Doch innerhalb der Null-Müll-Bewegung wird kritisiert, dass das Konzept eher Zero Home Waste heißen müsste – denn manchen Verpackungsmüll für ihre Ausgangsprodukte lassen die Zero Waster schlichtweg im Laden zurück. Damit fällt er nicht in ihre Bilanz. Was daheim noch an Abfall anfällt, wird aufgewertet, recycelt oder kompostiert.
Klingt irgendwie vertraut, wenn ich an meine Kindheit in Ostdeutschland denke. Damals warf man wenig weg – man reparierte und tauschte Möbel und Kleidung, gärtnerte sein eigenes Gemüse. Die Leute gingen sorgsamer und vorausschauend mit Lebensmitteln um, sie verreisten weniger und konsumierten ziemlich überschaubar. Freilich war das dem real existierenden Mangel geschuldet und weniger ein freiwilliges Konzept. Wie groß der Nachholbedarf war, zeigte sich nach dem Mauerfall: Allerorten Konsumwahn und ein geringes Bewusstsein gegenüber den (Umwelt)Folgen.
Denn Konsum war und ist auch immer Statussymbol, ist Ausdruck eines Mitmach-Gefühls im Alltag. Wer jemals richtig pleite war, fühlt sich dabei nicht besonders cool. Das viel gerühmte Nichts-Besitzen, der gehypte Verzicht auf so gut wie alles, so meine These, fühlt sich vielleicht nur super an, wenn man sich eigentlich fast alles leisten kann.
Ich frage mich daher heute, ob ich bei Zero Waste so konsequent durchhalten würde, ob meine Entscheidung mich nicht manchmal auch einfach langweilen oder in Widersprüche verstricken würde. Macht eiserne Konsequenz auch unspontan und hart? Wie geht man damit um, wenn Familie, Freunde oder Partner null Bock auf null Müll haben? Ist das Konzept wirklich bis zuende gedacht? Was ist beispielsweise mit dem Schutt passiert, der beim Bau meiner Wohnung oder der städtischen Infrastruktur anfiel? Müsste das nicht eine ewige “Müllschuld“ sein, die das “richtige” Zero Waste für mich unmöglich macht? Müssen wir Müll vielleicht hinnehmen, um gesellschaftliche Fortschritte zu erreichen? Sind Müll, Verschwendung und die Ausbeutung anderer sogar notwendig, damit wir in einer modernen und hochkomplexen Zivilisation leben können?
Eine Frage des Respekts
Vor 17 Jahren prägte sich dieses neue Wort – “Nachhaltigkeit” – in meinem Hirn ein, weil es so neu und ungewöhnlich war. Dass es mal ein Trend würde, von dem ich selbst ordentlich angefixt bin, hätte ich mir nicht vorstellen können. Mein kleines Nachhaltigkeitstagebuch beendete ich Anfang 2017 mit dem nüchternen Fazit, dass 100 Prozent Nachhaltigkeit eine echte Herausforderung bleiben. Denn häufig braucht es auch dafür einen enormen Zeitaufwand, um Angebote in Stadt oder Region wahrzunehmen, nach Alternativen zu suchen sowie Produkttests, Anbieter und Siegel zu vergleichen.
Nicht allen Menschen steht dieses Zeitbudget zur Verfügung, deshalb ist es hilfreicher, locker zu bleiben und die Ansprüche auf Weltrettung auch ab und zu mal ein bisschen runterzuschrauben. So schreibt beispielsweise die Zero Waste-Bloggerin Gabriele Rassow angenehm unaufgeregt darüber, wie Nachhaltigkeit auf dem Land funktionieren kann, wie man Kinder in die Idee einbindet, ohne sie zu überfordern oder ungewollt sozial auszugrenzen. Ihr Blog erschien mir ehrlicher und praktischer als jene der glamourösen Zero-Waste-Heldinnen. Bei ihnen fehlten mir Lösungen für viele alltägliche und persönliche Hürden, die Nachhaltigkeit trotz beschränkter finanzieller und zeitlicher Budgets ermöglichen.
Denn Nachhaltigkeit sollte letztlich mehr sein als nur ein sexy Lifestyle oder die Summe korrekter Kaufentscheidungen auf einem Nischenmarkt mit gut informierten Konsumenten. Im Kern sollten nicht die “richtigen” Produkte oder Dienstleistungen stehen, sondern auch das politische Bewusstsein darum, was man mit den eigenen Ressourcen von Geld und Zeit realistischerweise erreichen kann. Nachhaltigkeit orientiert sich dabei im Idealfall vor allem am Respekt – vor unserer Umwelt, vor den Bedürfnissen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, vor der Würde des Bauern von nebenan und der Näherinnen in Bangladesch.
Dieser Artikel erschien zuerst im deutsch-tschechischen Online-Magazin „jádu“ im März 2017.

Gastautorin Sylvia Lundschien studierte Europäische Ethnologie, Russisch sowie Interkulturelle Kommunikation. Nach ein paar Zirkusjahren in der Berliner Start-Up-Welt entschied sie sich Ende 2015 für den Journalismus. Seit Anfang 2017 lernt sie an der Evangelischen Journalistenschule Berlin und schreibt regelmäßig für das Indie-Magazin Kater Demos sowie das deutsch-tscheschische Projekt jádu.
Beitragsbild: Ben Neale, Unsplash