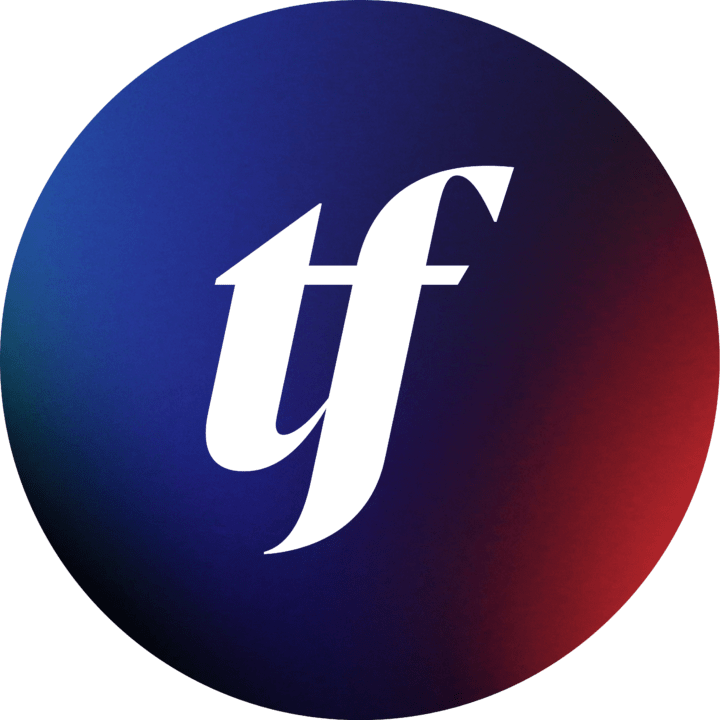Das Ersetzen von Dieselfahrzeugen durch Elektrofahrzeuge reicht für eine nachhaltige Mobilitätswende nicht aus: Vielmehr geht es um die Umgestaltung sozialer Beziehungen und um eine mentale Emanzipation.
Auch beim sogenannten Dieselgipfel Ende September 2018 kam für die Bundesregierung nur eine Alternative zum Auto infrage: das Auto. Debatten zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder der Fahrradinfrastruktur? Fehlanzeige! Trotzdem, die Stadt ohne Autos muss kein Traum bleiben. In Köln wird die Utopie der freien Straßen seit 2013 einmal jährlich Wirklichkeit. Beim “Tag des guten Lebens” sind dann zwischen 25 und 35 Straßen autofrei. Für die Bewohner/innen wird die autofreie Stadt damit konkret erfahrbar.
Wie geht die Stadt ohne Autos?
Von der autogerechten Stadt zu einer menschengerechten Stadt zu kommen ist eine zentrale Herausforderung der nachhaltigen Transformation im urbanen Raum. In was für einer Stadt wollen wir leben? Wie wollen wir zusammenleben? Welche Mobilität entspricht einem guten Leben? Wenn die Transformation mit solchen übergeordneten Fragen statt mit vorgegebenen Antworten beginnt, kommen die Menschen gemeinsam fast eigenständig und freiwillig dazu, das Auto stehen zu lassen. Der Autoverkehr reduziert sich dort, wo Menschen ihren Lebensraum gemeinsam mitgestalten dürfen statt als Erziehungsobjekte behandelt zu werden. Wenn es darum geht, Freiräume für eigene Konzepte des guten Lebens im Quartier zu schaffen, stehen Autos nur im Weg.

Wer möchte schon gerne an einer stark befahrenen Straße wohnen? Wahrscheinlich die wenigsten. Schon diese Tatsache zeigt, dass das Auto nicht unbedingt für ein gutes Leben steht. Wir brauchen Alternativen zu einem „Mehr vom Gleichen“ in der Verkehrspolitik, immer mehr Straßen für immer mehr Autos. Alternativen zum Anschauen gibt es genug: In Venedig etwa sucht man Autos vergeblich. Auch Amsterdam, Kopenhagen oder Münster haben sich lieber menschengerecht statt autogerecht entwickelt, ohne dabei an Attraktivität einzubüßen. Eine Reduktion und nicht eine Zunahme des Autoverkehrs bedeutet mehr Lebensqualität, eine gesündere Umwelt, weniger Lärm sowie mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. Eine Mobilität, die auf der begrenzten Ressourcen wie Erdöl (bei Benzin- und Dieselautos) oder auf Kupfer, Kobalt und Lithium (bei Elektroautos) basiert, ist nicht nur klimaschädlich, sondern nicht zukunftsfähig. Unsere Mobilität von solchen Ressourcen unabhängiger zu machen, bedeutet sie resilienter zu machen. Die Frage ist heute nicht mehr, ob wir einen radikalen Mobilitätswandel wollen oder nicht, denn dieser Wandel wird so oder so stattfinden. Wahrscheinlich sind wir bereits mittendrin. Die einzige Frage ist, ob dieser Wandel by design or by desaster stattfinden soll.
Stadt wird Gemeingut
Deshalb sollten wir die Entwicklung unserer Gesellschaft selbst in die Hand nehmen. Beginnen wir vor unserer eigenen Haustür, in unserer Nachbarschaft. Die Bürger/innen Kölns können am „Tag des guten Lebens“ ein ganzes Quartier selbst gestalten und regieren, Mobilität inbegriffen. Ein Stück Stadt wird dabei zum Gemeingut. Gemeingüter werden nachhaltig bewirtschaftet, wenn ihre Nutzer/innen (in diesem Fall die Bürger/innen) dazu gebracht werden, miteinander zu kooperieren – so Elinor Ostrom, die für ihre Studien zum Thema 2009 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt. Die Gemeinschaft der Nutzer/innen muss zusätzlich die Möglichkeit haben, das Gemeingut selbst zu verwalten. Kooperation klappt am besten dort, wo man sich kennt und persönlich miteinander interagieren kann. Weil unsere kognitiven und physischen Fähigkeiten begrenzt sind, können wir uns mit überschaubaren Einheiten wie unserer Nachbarschaft besser identifizieren als mit einer ganzen Stadt oder mit einer Nation – und diese emotionale Identifikation ist ein wichtiger Anreiz dafür, Verantwortung zu übernehmen.
Wenn wir diese Lehre auf die Mobilitätswende übertragen, sieht die Strategie so aus: Bringen wir die Autofahrer/innen, die Fahrradfahrer/innen, die Fußgänger/innen, ältere Menschen und Kinder in den Quartieren an einen Tisch, sodass sie sich zunächst als Nachbar/innen wahrnehmen und sich die verschiedenen Interessen auf Augenhöhe begegnen. Lassen wir diese Nachbarschaft die Mobilitätspolitik im eigenen Quartier demokratisch und inklusiv mitbestimmen. Die Stadtverwaltung sollte solche Prozesse ermöglichen und begleiten, die konkrete Umsetzung der entstandenen Konzepte dann unterstützen. Eine Transformation zur Nachhaltigkeit braucht mehr public-citizen-partnerships als public-private-partnerships.
Einen Tag lang ohne Autos auf den Straßen
Das kleine Straßenfestival in Köln verwandelt jedes Jahr einmal eine Auswahl von Straßen und die Plätze in einem ganzen Quartier in einen autofreien Freiraum. Auf den autofreien Straßen kann jede Nachbarschaft dann selbst entwickelte Konzepte des guten Lebens erproben und erleben, das heißt Wohlstandsmodelle jenseits der ökonomischen Wachstumslogik. Was das gute Leben ist und was auf den Straßen passiert, entscheidet jede Nachbarschaft für sich – unter vier Bedingungen:
-
- Das Auto bleibt stehen oder wird umgeparkt, sonst entsteht kein Freiraum.
-
- An diesem Tag darf nichts verkauft und nichts gekauft, sondern nur geteilt und geschenkt werden. Der “Tag des guten Lebens” soll kein kommerzielles Event sein, sondern durch soziale Interaktion das Vertrauen in der Nachbarschaft fördern, ein Stück Anonymität aufheben.
-
- Das gute Leben und das Programm auf der eigenen Straße wird in jeder Nachbarschaft möglichst demokratisch und inklusiv definiert.
- Selbstorganisation und Selbstverwaltung bedeutet auch Rechte und Pflichten einzuhalten. So sollten die Straßen am Ende des Tages so sauber sein wie am Anfang. Menschen, die in einer Straße auf das Auto nicht verzichten können (zum Beispiel aufgrund einer Behinderung), müssen von Ordnungskräften so begleitet werden, dass Fußgänger dabei nicht gefährdet werden.

Am häufigsten nutzen die Anwohner/innen den Freiraum auf den Straßen, um nachbarschaftliche Wohn- und Esszimmer einzurichten. Sie bringen Stühle, Tische und Sofas auf die autofreien Straßen, um dort mit den eigenen Nachbar/innen unter freiem Himmel zusammen zu sitzen, zu plaudern oder zu essen getragen werden, während die Kinder nebenan unbeschwert spielen können. Die Menschen erleben wie viel öffentliche Fläche der Umgebung für ungenutzte Fahrzeuge verschwendet wird. Jedes Auto bleibt im Durchschnitt 23 Stunden auf einem Parkplatz stehen. So ähnlich wie beim “Park(ing) Day” geht es beim “Tag des guten Lebens” diese sonst verschwendeten Flächen zurückzuerobern, umzuwidmen und kreativ zu gestalten. Über Gestaltung und Erleben lassen sich die Menschen leichter mobilisieren als über Sprache, weil damit die Emotionen stärker berührt werden. Nachhaltigkeit will eben gefühlt und nicht nur gedacht werden.
Mit Grundvertrauen zur wahren Sharing Economy
Leider findet das Bedürfnis nach selbstverwalteten Begegnungsräumen in der Nachbarschaft in der modernen Stadtplanung bisher kaum Berücksichtigung. Doch gerade in solchen Räumen kann jenes Grundvertrauen gebildet und gepflegt werden, welches das Teilen der Bohrmaschine, des Autos – aber auch von Solidarität und demokratischer Verantwortung- voraussetzt. Wenn wir mit der Förderung dieses Grundvertrauens im Lokalen beginnen, leisten wir einen Beitrag zur Mobilitätswende. Dort wo Menschen zusammenhalten, braucht keiner ein Luxusauto, um sich von der Masse abzuheben und seinen sozialen Status zu unterstreichen. Die Hemmschwelle, das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen ist niedriger, wo der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Gemeinschaft einen höheren Stellenwert haben als Abgrenzung.
In Deutschland haben es nachhaltige Mobilitätskonzepte nicht leicht, vor allem wo die Interessen der Autoindustrie berührt werden. Wenn die Abkehr von der autogerechten Stadt nicht von oben nach unten vorangetrieben wird, braucht es eben einen Druck von unten nach oben. Dafür reichen jedoch vereinzelte Umweltinitiativen nicht aus, vielmehr braucht es eine breite gesellschaftliche Bewegung verschiedener Akteure.
Im Kiez ist man oft weiter als in der großen Politik
Wie sind solche unkonventionellen Allianzen im Lokalen unter Akteuren aus Umwelt, Gewerbe, Soziales und Kultur möglich? Indem man die Stadt oder das Quartier zum gemeinsamen Identifikationspunkt macht und dabei versteht, dass viele Probleme ineinandergreifen: Sie können nur zusammen statt getrennt gelöst werden. Zum Beispiel, sind Probleme der Nachhaltigkeit und der Mobilität Probleme der Demokratie. Wer bestimmt die Verkehrspolitik für welche Interessen? Wie viel Einfluss haben die Bürger/innen wirklich? In Sache Mobilitätswende sind die Bürger/innen teilweise viel weiter als ihre eigenen politischen Vertreter/innen. Nachhaltigkeit bedeutet nicht eine zusätzliche Fremdbestimmung, sondern eine stärkere Demokratie.

Die Frage nach nachhaltiger Mobilität hat auch eine soziale Dimension. Die höchste Autodichte (besessene und geparkte Autos) ist oft in den wohlhabenden, grünen Quartieren der Städte vorhanden, während die Mieten an stark befahrenen Straßen am niedrigsten sind. Dort wo sich die Menschen kein eigenes Auto leisten können, müssen sie paradoxerweise mehr Abgase einatmen, haben aber keine starke Lobby, um das Problem zu lösen. Warum sollten die Privilegierten etwas ändern wollen, wenn sie die negativen Auswirkungen ihres Handelns nur sekundär tragen müssen? Global wie lokal ermöglichen die Strukturen der sozialen Ungleichheit eine Privatisierung der Vorteile bei gleichzeitiger Externalisierung der Kosten, sprich: Auch in der Verkehrspolitik leben wir oft auf Kosten anderer. Viele Probleme der Nachhaltigkeit sind schließlich ideologischer Natur. Welche Werte dominieren in unseren Stadtverwaltungen oder in der Autoindustrie? Wird dort mehr auf Menschen oder auf Zahlen geachtet? Deswegen bedarf es einer mentalen Emanzipation vom Glaubenssatz, wonach das Auto wie das Wirtschaftswachstum notwendig seien. Warum monatlich zwischen 185 und 1.000 Euro für den Kauf, den Betrieb und die Instandhaltung eines Autos ausgeben, das so oft lediglich auf einem Parkplatz oder im Stau steht, wenn für eine durchschnittlich geringere Steuerabgabe die Infrastruktur von ÖPNV, Fahrrad und Fußgängern stark ausgebaut werden könnten, Menschen mit Bus und Bahn kostenlos fahren würden?
Amsterdam und Kopenhagen nachahmen
Nicht neue Autotechnologien führen zur Mobilitätswende, sondern mehr Gemeinwesen statt Privatwesen. Weil eine autogerechte Stadt autogerechte Menschen bildet, brauchen wir eine andere Kultur in der Stadtplanung. Städte sollten so gebaut werden, dass Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsorte in Reichweite liegen. Was in Amsterdam oder Kopenhagen so gut funktioniert, ist auch in Dresden, Köln oder Stuttgart möglich. Gemeinsam können wir unsere eigene Stadt zu einem Ort machen, in dem wir sogar unseren Urlaub gerne verbringen.

Gastautor: Davide Brocchi (geboren in Rimini, 1969) lebt in Köln. Er ist Dipl.-Sozialwissenschaftler, Initiator des “Tags des guten Lebens” und des Bündnisses Agora Köln. Weitere Informationen:
Illustration: Mojgan Harati