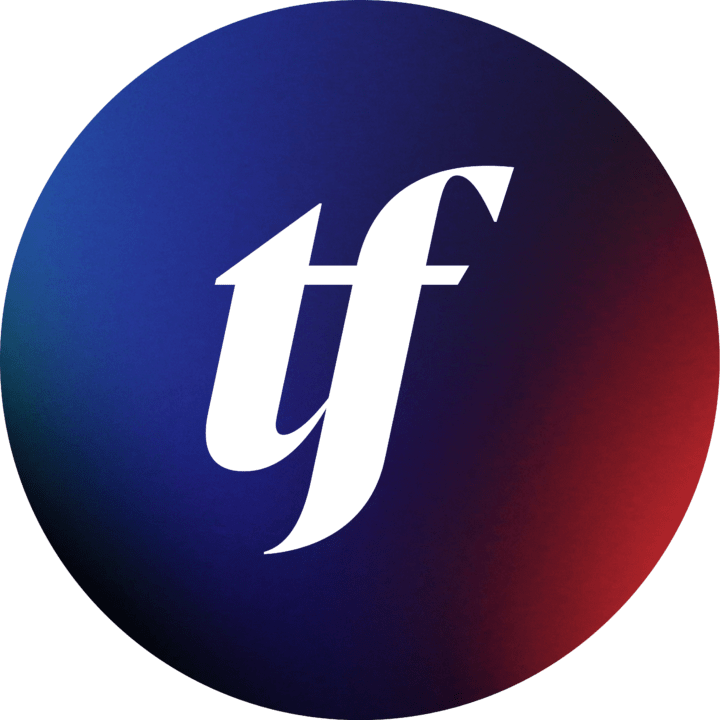Als ich vor einiger Zeit eine Einladung an die jungen “Wissenschaftler” meiner früheren Universität verschickte, kam prompt eine Reaktion: Ich möge doch geschlechtergerechte Sprache verwenden. Andere Ungenauigkeiten in meinem Schreiben waren unbemerkt geblieben, aber offensichtlich war dies ein sehr sensibler Punkt.
Wir wenden inzwischen viel Zeit dafür auf, *innen anzuhängen, von mensch statt man zu sprechen und Ansprechpartner zu Ansprechpersonen zu machen; das sind die einfacheren Beispiele. Wenn man einen solchen Aufwand betreibt, ist die Frage berechtigt, ob der Aufwand in Relation zum Nutzen steht. Wird die Welt durch diese sprachlichen Bemühungen direkt geschlechtergerechter?
Ich denke nein: Wenn ich bei unseren Fußballfrauen von einer Frauschaft statt einer Mannschaft spreche, wird der Fußball nicht frauengerechter. Effektiver wäre es, die Frauen-WM ähnlich stark zu bewerben und prominent auszustrahlen wie die Männer-WM. Umgekehrt erzeugt man mit beständiger Kritik an sprachlichen Feinheiten, manchmal wahre Haarspaltereien, nicht selten eine Gegenstimmung: Man schaue nur mal in die Diskussionsforen, in denen geschlechtergerechte Sprache verrissen wird, und das nicht nur vom rechten Rand her. Wie unglücklich geschlechterbezogene Themen in der Öffentlichkeit oft verhandelt werden, zeigt Margarete Stokowski am Beispiel des Manspreading, und ich denke, dass die Art, wie geschlechtergerechte Sprache propagiert wird, inzwischen dazugehört.
Die Idee, dass eine geschlechtergerechte Sprachplanung zu mehr Gerechtigkeit führt, fußt auf einigen Fehlannahmen über die Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit. Wir wissen tatsächlich noch zu wenig über diese Beziehung, sie ist aber deutlich fluider, als wir im Allgemeinen annehmen. Ich denke, dass wir zuviel Energie für die künstliche Herstellung einer Geschlechtergerechtigkeit von Sprache aufwenden, die wir besser dafür einsetzen könnten, auf anderen Feldern für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen.
Sprache und Wirklichkeit
Unsere Sprache sagt viel über uns selbst aus, wo wir herkommen, was wir glauben, ganz generell: Wie wir ticken. Die körper- und genußbetonte Flowerpower-Jugend fand Dinge dufte, in den 1990ern, als die Welt eine Party zu werden schien, war alles Tolle cool und geil, für die Krisenkids wiederum waren bemerkenswert gute Dinge stabil. Gleichzeitig schleppt unsere Sprache manchmal Überbleibsel mit, die uns gar nicht mehr auffallen. Ohne mit der Wimper zu zucken sprechen wir von der Frauenmannschaft oder der Landsmännin, beides eigentlich ein Widerspruch in sich.
Im zwanzigsten Jahrhundert war es gerade philosophisch sehr schick, sich der Sprache zu widmen unter der Annahme, dass man sich die Sprache ansehen müsste, wenn man über die Wirklichkeit mehr erfahren will. Aus dieser Zeit stammen extreme Annahmen wie die Sapir-Whorf-Hypothese: Die Sprache, die wir Sprechen, würde unser Denken bestimmen, nicht nur ihre Wörter, sondern auch ihre Grammatik. Diese These wurde allerdings nie breit akzeptiert. In der Konsequenz würde das nämlich heißen, dass Finnen schlechter zwischen den Geschlechtern Mann und Frau unterscheiden können, weil sie kein grammatisches Geschlecht haben – es gibt noch nicht mal unterschiedliche Personalpronomen für Frauen und Männer. Allerdings könnte es schwer sein, für diese Schlussfolgerung Belege zu finden.
Mentale Räume und fruchtbarer Nährboden
Unsere Sprache kann deutlich mehr, als nur die Wirklichkeit darzustellen: Wir können zum Beispiel auch Märchen erzählen. Wie Fauconnier und Turner in ihrer Theorie der mental spaces darlegen, sind wir in der Lage dazu, uns mentale Räume zu schaffen, in denen wir viele Bedingungen selbst bestimmen. Ich kann sagen “Wenn ich der Papst wäre…” und mit anderen sogar darüber diskutieren, was ich täte, wenn ich der Papst wäre, obwohl alle wissen, dass ich niemals Papst war oder sein werde.
Wir prägen also unsere Sprache, aber beeinflusst unsere Sprache uns? Sprache hat durchaus auch Einfluss auf unsere Realitäten, also die Welt, die wir definieren, unsere Gesellschaft, die wir konstruieren etc. Wenn ständig über eine Flüchtlingskrise gesprochen wird, glauben wir irgendwann an diese Krise. In so einer Stimmung kann ein Zeitungstitel mit dem Wort Flüchtlingstsunami durchaus intensive Ängste auslösen. Dafür muss aber vorher der Nährboden geschaffen werden. Sprache kann nicht einfach aus sich heraus Wirklichkeit erschaffen. Wenn Mama oder Papa beherzt in den Rosenkohl beißen und dabei “Mmmmhh, lecker!!” rufen, schmeckt er dem Kind danach nicht unbedingt besser.
Die queere Sprachkritik fußt aber implizit auf dieser Annahme, dass ich mit Sprache recht simpel Realitäten schaffen kann, also zumindest die von uns selbst definierte Welt beeinflussen kann: Wenn ich von Arbeitnehmer*innen spreche, würde ich damit, so das Argument, gleichzeitig an alle Geschlechter denken, auch an Transmenschen, Intersexuelle etc. Ganz abgesehen davon, dass das schwer nachzuweisen ist (vielleicht denke ich auch einfach daran, dass man das nun so schreiben muss), führt das denn direkt dazu, dass bald mehr Trans- oder Intermenschen in allen möglichen Berufsfeldern zu finden sind, oder braucht es dafür nicht eine lange Aufklärungsarbeit?
Grammatische Geschlechter nicht übersexualisieren
So, wie ich zwischen Sprache und Wirklichkeit keine Eins-zu-eins-Beziehung herstellen kann, so kann ich meine sozialen Kategorien wie zum Beispiel Geschlecht auch nicht eins-zu-eins auf Sprache anwenden. Die deutsche Sprache kennt drei so genannte grammatische Geschlechter: Maskulinum, Femininum und Neutrum. Tatsächlich ist es so, dass viele Dinge, die auch biologisch männlich sind, ins Maskulinum verschoben werden, also etwa der Mann, aber auch der Hengst oder der Eber. Interessanterweise verliert die deutsche Sprache diese grammatischen Kategorien spätestens im Plural: Egal ob Maskulinum, Femininum oder Neutrum, das Artikelparadigma im Plural ist gleich dem des Femininum im Singular (als die Männer, der Männer, … so wie die Frau(en), der Frau(en), …). Auch Adjektive richten sich insgesamt eher nach dem Deklinationsschema des Femininum.
Wenn wir jetzt also davon ausgehen würden, dass grammatische und biologische Geschlechterkategorien genau gleich sind, könnte man fast sagen, dass die deutsche Sprache in gewisser Weise geschlechtergerecht ist. Grammatische Geschlechter haben aber vielfältige Funktionen, die nicht unbedingt etwas mit dem biologischen Geschlecht zu tun haben, wie in einer Handreichung von Martina Werner zur (Nicht-)Beziehung zwischen grammatischem Geschlecht im Deutschen und biologischem Geschlecht zusammengefasst wird. So stehen “maskuline” Nomen oft für zählbare Dinge oder mit der Endung -er für Dinge oder Menschen, die bestimmte Tätigkeiten verrichten, wie beim Staubsauger oder Entsafter. “Feminine” Nomen hingegen beschreiben häufig abstrakte Einheiten, wie etwa die Wichtigkeit oder die Einfachheit, oder abstrakte, oft länger andauernde Prozesse wie die Bildung oder die Gründung. Konkrete Prozesse hingegen stehen gerne im Neutrum, wir sprechen also nicht von der “Umtopfung”, sondern vom Umtopfen. Diese Prinzipien sind im Endeffekt wichtiger als das biologische Geschlecht, so sagen wir eben in der Grundform die Mannschaft und nicht “der Mannschaft”.
Tatsächlich gibt es eine gewisse Überschneidung zwischen biologischem und grammatischem Geschlecht, allerdings sind Benennungen wie “Maskulinum” doch irreführend und man darf diese Beziehung nicht überbetonen, also die grammatischen Kategorien nicht übersexualisieren. Alternativ könnte man einfach von der “der-Deklination”, “die-Deklination” oder “das-Deklination” sprechen, ausgehend vom Artikel in der Grundform, um den Druck herauszunehmen, die Benennungen wie “Maskulinum” erzeugen.
Sprachkritik kann für andere abwertend sein
Die queere Sprachkritik hat neben den teils etwas wackeligen philosophischen und sprachwissenschaftlichen Grundannahmen noch ein anderes Problem: Sie übersieht andere Funktionen von Sprache. Die Art wie ich spreche, wie meine Freunde sprechen und die Menschen meiner Region, stehen in vielerlei Hinsicht für meine Identität. Ich habe eine dialektale Färbung und meinen ganz eigenen, persönlichen Sprachgebrauch. Das bedeutet auch: Wer meine Sprache kritisiert, der kritisiert mich.
Die queere Sprachkritik hat sich ein hehres Ziel gesetzt, nämlich in der Sprache für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Sprache eignet sich tatsächlich gut dafür, bestimmte Verhältnisse herauszuarbeiten und einige Aussagen über unsere Realität zu machen. Wer aber anderen diktieren will, wie sie zu sprechen haben, sendet auf dem persönlichen Kanal keine freundliche Botschaft. Unsere Sprache besteht aus vielen Gewohnheiten, die nicht unbedingt eine direkte Aussage haben. Jemand, der “Mannschaft” sagt, ist damit nicht automatisch Sexist, ebenso wenig wie jemand, der “jemand, der” schreibt. Der Zusammenhang zwischen unserem Gedankengebäude, unseren Überzeugungen, unserem Glauben etc. einerseits und unserer Sprache andererseits ist viel komplexer und subtiler.
Ein Problem der queeren Sprachkritik ist aber, dass die Kritik gelegentlich derart heftig geäußert wird, dass beim Empfänger eigentlich nur eine Botschaft ankommen kann: Wir finden dich scheiße. Dies kann von anderen aufgegriffen und umgedeutet werden: Gerade deshalb spricht die Alte-Neue Rechte gerne von einer “Denk-“oder “Sprachpolizei” – man spielt seinen Gegnern damit also auch noch in die Hände.
Muss ich nun gar nicht mehr auf Sprache achten?
Es ist ein Paradoxon unserer Zeit, dass wir uns selbst aus vielen Ebenen Entspannung verordnen, hier aber nicht: Wir beschwören die Slowness herauf und wollen Fünfe auch mal gerade sein lassen, aber gerade auf dem Feld der geschlechtergerechten Sprache begegnet mir häufig Verbissenheit.
Das heißt auf der anderen Seite wiederum nicht, dass wir nun gar nicht mehr auf Sprache achten sollen. Wir können uns sicher einig sein, dass schwul kein geeignetes Schimpfwort ist und dass Medien, die nicht hetzen wollen, besser nicht von einem Flüchtlingstsunami sprechen. Ganz ohne Einfluss ist unsere Sprache nicht, wir sollten ihr aber auch keinen übermächtigen Einfluss zuschreiben.
Ich halte zudem nichts davon, alle abzuurteilen, die nicht mit Sternchen oder mensch schreiben. Genauso erkenne ich an, dass die Sternchen- oder mensch-Schreibweise für manche Menschen durchaus Identität bedeutet: Gerade in bestimmten politischen Lagern ist sie Ausdruck eines eigenen Selbstverständnisses. Bei transform steht es den Beitragenden frei, ihre Variante zu wählen, es ist also Teil ihrer Ausdrucksweise. Man könnte kritisch einwenden, damit würde nur eine Entscheidung vermieden, es fällt dadurch aber auch der Druck weg, den eigenen Artikel peinlichst genau auf nicht-genderkonforme Ausdrücke zu durchleuchten. Unsere Energien, die wir für die Herstellung von mehr Geschlechtergerechtigkeit aufwenden wollen, sollten wir eher auf verschiedene Realitäten verwenden, anstatt uns mit sprachlichen Spitzfindigkeiten aufzuhalten.
Beitragsbild: Steffi Reichert, CC-BY-NC-ND