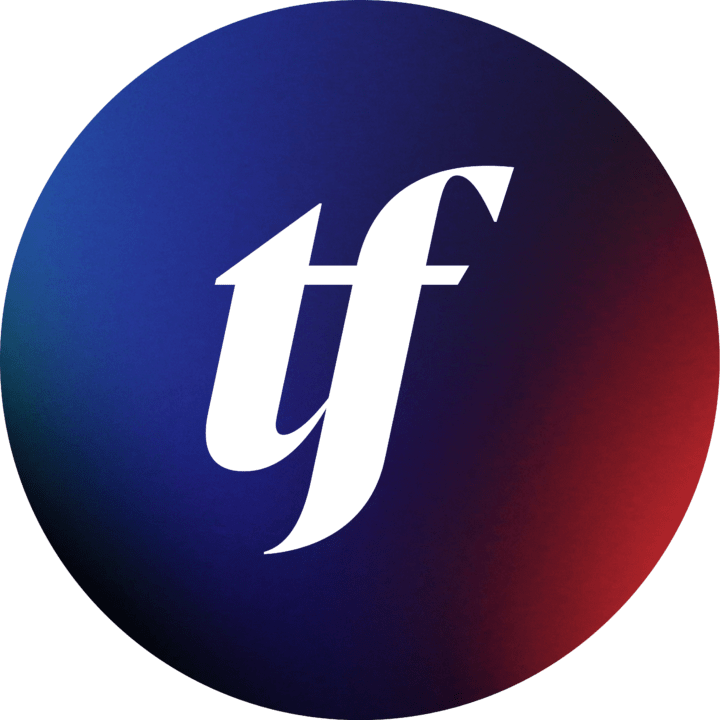Hunderttausende protestieren in der Ukraine gegen die Regierung. Unzählige stehen auf für ein Leben ohne Waffengewalt in den USA. Das sind Bilder, die im Gedächtnis bleiben, Momente der Konfrontation. Mit Demonstrationen machen Menschen ihrem Ärger Luft. Aber was bringt es eigentlich, auf diese Weise Dissens zu zeigen? Zum Sinn von Demonstrationen.
Im Jahr 2009 untersuchten Harvard-Wissenschaftler den Aufstieg der erzkonservativen Tea Party-Bewegung und ihren Zusammenhang mit den darauffolgenden US-Zwischenwahlen. Die Bewegung hatte ihre Offensive mit Großkundgebungen am 15. April begonnen, jedoch in verschiedenen Städten unter unterschiedlichen Voraussetzungen: Mancherorts regnete es, während andernorts die Sonne schien. Die Wissenschaftler zeigten, dass in sonnigen Orten mehr Menschen die Tea Party-Demonstrationen besuchten, in den sozialen Medien mehr für ihre Positionen warben und die Abgeordneten daraufhin wesentlich konservativer abstimmten als dort, wo es geregnet hatte. Das werteten die Wissenschaftler als Indiz dafür, dass Straßenproteste einen direkten Einfluss auf die Politik haben können.
Ein ähnlicher Zusammenhang ließe sich wohl zwischen Pegida und der verschärften Rhetorik deutscher Politiker beim Thema Migration feststellen. Wäre die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, ohne Pegida zu einem raumgreifenden politischen Diskussionspunkt geworden? Wäre Horst Seehofer Innenminister und Herr über ein Heimatministerium? Straßenproteste können ohne Frage einen großen politischen Einfluss haben. Wie aber ist der zu erklären? Und: Wenn ich auf die Straße gehe, kann ich dann mit Veränderungen in meinem Sinne rechnen? Peter Ullrich ist Soziologe am Zentrum für Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin und beschäftigt sich dort mit sozialen Bewegungen, Protest und Demonstrationen. Fragen wir ihn.

transform: Eine kurze Einschätzung – wie haben sich Protestformen seit 1968 entwickelt?
Peter Ullrich: Eine große Frage. Protest hat sich generell normalisiert. Das heißt, er ist üblicher geworden und nicht mehr so sehr mit bestimmten politischen Lagern verknüpft. Die Protestformen haben sich vervielfältigt.
Wie zeigt sich diese Vielfalt?
Unterschiedliche soziale Gruppen neigen zum Beispiel zu unterschiedlichen Protestformen. Wie jeweils protestiert wird, hängt aber auch davon ab, wie die gesellschaftlichen und staatlichen Reaktionen darauf sind. Viele Protestformen sind Ausdruck von »Sicherheitskulturen«, wie wir das nennen. Die Form des Schwarzen Blocks zum Beispiel ist eine strategischen Entscheidung. Der tritt auf diese Weise auf, um sich gegen staatliche Eingriffe zu schützen und die Anonymität Einzelner zu wahren. Das ist natürlich nur eine Form. Manche sind expressiver veranlagt, andere sind eher ernster. Die libertären Linken demonstrieren in der Regel bunter als die Junge Union, aber alle nutzen die Protestform Demonstration.
Was macht die Demonstration als Methode des Protests so populär?
Demonstrationen sind eines der etabliertesten Mittel, um zu protestieren. Wenn man auf ihre Vorgeschichte blickt, kommt man schnell bei Prozessionen, also eher religiösen Aufzügen, an. Das sagt schon ziemlich viel über ihre gesellschaftliche Bedeutung. Demonstrationen richten sich zwar immer an das Außen, adressieren den Protest an jemanden. Gleichzeitig haben sie aber auch ganz stark die Funktion der Selbstvergewisserung, der Identitätsbildung. Wenn man große Mengen von Menschen hinter Fahnen, Bannern und Slogans versammelt, ist ein wichtiger Aspekt, dass man sich der eigenen Stärke und Zusammengehörigkeit versichert.
Ist das nicht auch im Netz möglich, etwa über Shitstorms oder Online-Petitionen? Auch daran ist ja abzulesen, dass sich eine Masse hinter eine Meinung stellt.
Da gibt es große Unterschiede. Der Klicktivismus — der Aktivismus, der sich nur online abspielt — ist sehr begrenzt und sehr unverbindlich. Leute, die auf Demonstrationen gehen, sind oft aus dem Umfeld des Bewegungskerns. Dieser Kern, also die Menschen, die den Protest organisieren, sind eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, langfristig schlagkräftig zu sein. Sie bewirken, dass man am Thema dranbleibt, bis etwas erreicht ist. Beim Klicktivismus kann man ohne soziale Bindung mal schnell nebenbei seiner Empörung Ausdruck verleihen oder ein Anliegen unterstützen. Diese Unterstützung kann aber schnell wieder verpuffen.
Auch bei Demonstrationen laufen aber viele Menschen einfach mal mit, ohne sich langfristig zu engagieren. Wie gelingt es Bewegungen, sie an sich zu binden? Und warum ist das online schwieriger?
In der Regel stehen hinter Demonstrationen Bündnisse von politischen Gruppen. Die sind kontinuierlich aktiv. Auf einer Demonstration tauscht man sich auch aus, bestärkt sich gegenseitig oder scheitert gemeinsam, wenn zum Beispiel kaum jemand kommt. Man macht Erfahrungen und beschäftigt sich mit den Positionen. Das ist etwas anderes als wenn die eigene Beteiligung nur darin besteht, ein Häkchen irgendwo zu setzen und Kontaktdaten einzugeben. Der Online-Aktivismus ist so niedrigschwellig, dass er oft einmalig bleibt. Viele Leute sind nicht dauerhaft politisch involviert, auch, weil sie keine politischen Erfahrungen machen.
Sie haben die Langfristigkeit als wichtiges Kriterium für den Erfolg von Protesten ausgemacht. Wenn Online-Aktivismus eher punktuell bleibt, hat er dann grundsätzlich weniger Schlagkraft als Demonstrationen?
Wenn Online-Aktivismus schon bestehende Strukturen verstärkt, ist er sicherlich förderlich, weil man damit noch einmal andere Menschen erreicht. Wenn man sich aber ansieht, wie viele Petitionen es mit nur hundert oder sogar weniger Unterstützern es gibt, muss man doch feststellen, dass die Schlagkraft oft begrenzt bleibt.
Kann der sogenannte Klicktivismus nicht trotzdem als Indikator für gesellschaftliche Stimmungen gesehen werden? Die NGO Campact etwa hat bei ihren Online-Petitionen ja oft eine sehr hohe Beteiligung und kann zeigen, dass es bei bestimmten Themen eine große Resonanz gibt.
Campact kann zwar teilweise viele Klicks generieren, wenn aber eine Aktion vor Ort stattfindet, kommen oft nur wenige. Es ist eben wirklich schwierig, Menschen auf diesem Wege langfristig politisch zu aktivieren. Top-down organisierte Beteiligungsformen wie Online-Petitionen leben davon, dass es eine Art Manager gibt, die alles organisieren, sodass man nur noch zustimmen muss — von oben nach unten also. Das ist ein Politikansatz, der klar von wirtschaftlichen Steuerungsmodellen inspiriert ist.
Akteure wie Campact versuchen, mit möglichst geringem Ressourceneinsatz möglichst große Effekte zu erzielen. Das Prinzip ist: Wir haben Menschen, die ein Anliegen haben und politisch etwas erreichen wollen. Und diese werden nach Eignung eingesetzt. Die, die zeichnen können, malen zum Beispiel Transparente und die, die in Berlin wohnen, sollen sich am Tag X an einem bestimmten Ort treffen und bekommen dann Plakate in die Hand gedrückt. Solche Protestgruppen sind ein Feld des Übergangs, wo Bewegungen irgendwann zu Nichtregierungsorganisationen und Lobbygruppen werden. Dahinter steckt eine ökonomische Logik.
Eigentlich wird es den Menschen durch eine solche Organisationsform doch einfacher gemacht, zu protestieren. Sie müssen weniger Zeit aufwenden und haben weniger Verantwortung. Genau darin sehen Sie das Problem?
Zumindest steht Klicktivismus im Gegensatz zu zum Beispiel dem linksradikalen Protestmilieu, das den gelenkten Online-Aktivismus oft kritisch sieht. Denn dem wohnt etwas Passives inne. Dort will man aber Empowerment — Stärkung der eigenen und kollektiven Handlungsfähigkeit. Damit ist auch der Gedanke gemeint, dass sich Teilnehmende selbst verändern, indem sie positive kollektive Erfahrungen machen, sich somit ermächtigen und gestärkt in ihren Idealen aus dem Protest gehen.
Welche Bedeutung haben Social Media heute für Protest?
Social Media sind dafür verantwortlich, dass einige bisher ziemlich randständige Protestmilieus zueinander finden, größer und sichtbarer werden. Das betrifft beispielsweise die Reichsbürger. Auch das Milieu, aus dem die Montagsmahnwachen erwachsen sind, nutzte diese Kanäle. Bei den Mahnwachen kam eine völlig widersprüchliche Mischung von Leuten zusammen, Linke, Rechte, Unpolitische, VerschwörungstheoretikerInnen, EsoterikerInnen. Die konnten sich auf ein paar Grundsätze einigen, die völlig vage waren, wie »Wir lassen uns nicht spalten«. Aber wenn man genauer fragte, kam man bei all den Leuten auf sehr unterschiedliche Motivationen. Dass die plötzlich für einen begrenzten Zeitraum für ein Thema zusammenfanden und auf die Straße gingen, ist eine direkte Folge der Kontaktmöglichkeiten über Social Media.
Inwieweit ist der Erfolg von Protesten messbar?
Das ist eine der großen Schwierigkeiten. Was man relativ gut ablesen kann, ist die mediale Resonanz, also: Wird über den Protest berichtet und bekommen die Protestierenden mit ihren Positionen dabei viel Raum oder doch nur die Polizei? Dazu haben Kollegen Protestereignisanalysen durchgeführt. Die haben einerseits gezeigt, dass Proteste immer häufiger werden und andererseits, dass mehr darüber berichtet wird. Das ergibt allerdings eine Aufmerksamkeitskonkurrenz. Protest muss sich ganz schön was einfallen lassen, um Beachtung zu finden. Die Größe ist ein Kriterium dafür, ein anderes sind spektakuläre Aktionen, die gute Bilder produzieren.
Lassen sich tatsächliche politische Veränderungen auf bestimmte Demonstrationen zurückführen?
Die langfristigen Effekte sind sehr schwer zu messen. Das beste Beispiel dafür ist der Atomausstieg. Der wäre nach Fukushima nicht gekommen ohne die jahrzehntelange Umwelt- und Anti-Atom-Bewegung. Der anhaltende Druck war schließlich dafür entscheidend, dass sich in der Krise etwas geändert hat. Aber so etwas wird nicht durch eine einzige Demonstration ausgelöst. Das sind viele Aktionen, die über eine gewisse Zeit erfolgen.
Was würden Sie als Status quo für das Mittel Demonstration festhalten?
Die Anzahl der angemeldeten Versammlungen steigt kontinuierlich. Andere Protestformen kommen eher dazu, als dass sie Demonstrationen ersetzen. Natürlich gibt es gerade Rahmenbedingungen, die nicht unbedingt förderlich für das Engagement sind: Neoliberalismus und der stete Zwang zur Selbstoptimierung, also, dass Menschen angeleitet werden, Probleme eher bei sich selbst zu suchen als die Gesellschaft zu adressieren. Aber auch in früheren Zeiten waren die Bedingungen nicht unbedingt besser. Man denke an das autoritäre Klima der 60er Jahre.
Heraus zur Demo? Heraus zur Demo!
50 Jahre ist es nun her, dass sich die 68er trotz gesellschaftlicher Ablehnung aufgeschwungen haben, um Patriarchat, Kalten Krieg, verknöcherte Universitätsstrukturen und Geschlechterrollen anzugreifen. Was, wenn nicht das, könnte Antrieb sein für eine Gesellschaft, die Freiheit und Frieden nicht erst erkämpfen muss, sondern diese Errungenschaften bewahren will?
Wir können heute aus uns machen, was wir wollen, unsere Partner selbst wählen und leben friedlich in einem pluralistischen Staat zusammen. Aber: Der Alltag vieler ist von Stress und Existenzängsten geprägt, Menschen essen Tiere, die ein qualvolles Leben hatten, die deutsche Regierung exportiert Waffen in autoritäre Staaten, es gibt viel zu wenig Bildungsaufsteiger, den Klimawandel, und fast 13 Prozent der Deutschen haben bei der Bundestagswahl 2017 eine rechte Partei gewählt. Trotz des Glücks, an einem Ort ohne Krieg, dafür aber mit vielen, vielen Freiheiten zu leben, gibt es einiges, wogegen zu protestieren wäre. Die Gelegenheiten, das zu tun, sind mannigfaltig.
Demonstrieren ist eine Selbstermächtigung.
Die Anti-Atom-Bewegung, der Feminismus und letztlich sogar Pegida haben gezeigt, dass es möglich ist, über Protest eigene Themen auf die Agenda zu zwingen — zumindest, wenn langfristig protestiert wurde. Dass die klassische Demonstration nach wie vor eine tragende Rolle dabei spielt, ergibt sich nicht nur, aber auch daraus, dass sie Gruppenerlebnisse generiert und politische Identitäten festigt. So werden Meinungen zu Überzeugungen und schließlich, wenn die Bewegung durchhält, zur politischen Kraft. Demonstrieren ist eine Selbstermächtigung und sie kann einen Schmetterlingseffekt auslösen, vor allem, wenn der Protest medienwirksam inszeniert wird.
Protestbilder zum Teilen
»The revolution will not be televised«, propagierte 1970 der US-amerikanische Musiker Gil Scott Heron. Er wollte mit seinem Spoken-Word-Gedicht die Afroamerikaner zu einem kritischen Bewusstsein gegenüber einlullenden weißen Medien aufrufen, welche ethnische Diskriminierungen ausklammerten. »Die Revolution findet auf der Straße statt, nicht beim passiven Fernsehen, also erhebt euch!«, so die Aussage. Heute, in Deutschland, ist die Situation ein bisschen anders: The revolution will be televised, denn die Medien, ob Mainstream oder soziale Plattform, können zu Komplizen einer Bewegung werden. Sie sind es, die die Bilder des Protests in die Breite streuen, sie auch der politischen Führung vermitteln.
Weil Demonstrierende sich das zunutze machen können, ist auf die Straße zu gehen nach wie vor eine hochwirksame Weise, Kritik sichtbar zu äußern. Pressebilder von Demonstrationen fungieren als Kampagnenfotos für Überzeugungen, als bunte Inhalte zum Teilen in den Social Media, wo weitere potenzielle AktivistInnen zu finden sind.
Keineswegs berichten die Medien neutral. Forschende des unabhängigen Instituts für Protest- und Bewegungsforschung haben etwa gezeigt, dass Gewalt schnell politische Forderungen aus den Schlagzeilen verdrängen kann. Auch gibt es zwischen liberalen und konservativen Medien große Unterschiede, was den Ton der Berichterstattung betrifft. Wohlwollen oder Ablehnung — auch damit können Protestgruppen arbeiten.
Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Demonstrierens kann wohl keine einfache sein — zu komplex sind Demonstrationen als soziale Prozesse. Vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis eine Feststellung: Nicht die einzelne Demonstration bewirkt die Veränderung, aber die Veränderung kann aus einzelnen Demonstrationen gemacht sein. Also Marker gezückt und Plakate gemalt. Weil es möglich ist, die Welt mitzugestalten.

Die Autorin Josephine Macfoy ist nach ihrem Studium der Europäischen Ethnologie und Germanistik im Journalismus angekommen. Dieser kann Fenster öffnen, findet sie. Welche in den Weltuntergang und welche in bessere Zeiten. Sie hat sich für die zweite Variante entschieden.
Dr. Dr. Peter Ulrich — Der hier interviewte Soziologe am Zentrum für Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin erforscht unter anderem das Verhältnis von Protest zu Politik und Polizei.
Titelillustration von Paul Butterer lebt er als selbständiger Illustrator und unselbstständiger Kino-Mitarbeiter im schönen Münster, wo er mit einigen Freund:innen eine Ateliergemeinschaft gründete.

Dieser Beitrag stammt aus unserer neuesten Ausgabe zum Thema „Luxus“! Und die kannst du dir hier bestellen. Damit unterstützt du unsere Arbeit.
Quellen
Klicktivismus
Reichweitenstark aber unreflektiert? Lya Cuéllar, Bundeszentrale für politische Bildung (2017) | bpb.de
Does political protest matter? Evidence from the Tea Party Movement. Madestam, A., Shoag, D., Veuger, S., Yanagizawa-Drott, D. (2013). The Quarterly Journal of Economics, 128(4) | dash.harvard.edu
Zwischen Emphase und Aversion – Großdemonstrationen in der Medienberichterstattung. Teune, S., Sommer, M., Rucht, D. (2017). ipb working papers (PDF) | protestinstitut.eu
Weiterlesen
Dafür statt dagegen—neue Bürgerbewegungen / Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung | bpb.de Kollektives Handeln—Außerparlamentarischer Aktivismus / Julia C. Becker (2013). In-Mind, 3(2013). | in-mind.org
Is there any point to protesting? -Nathan Heller. The New Yorker, 21. August 2017. (Englisch) | newyorker.com