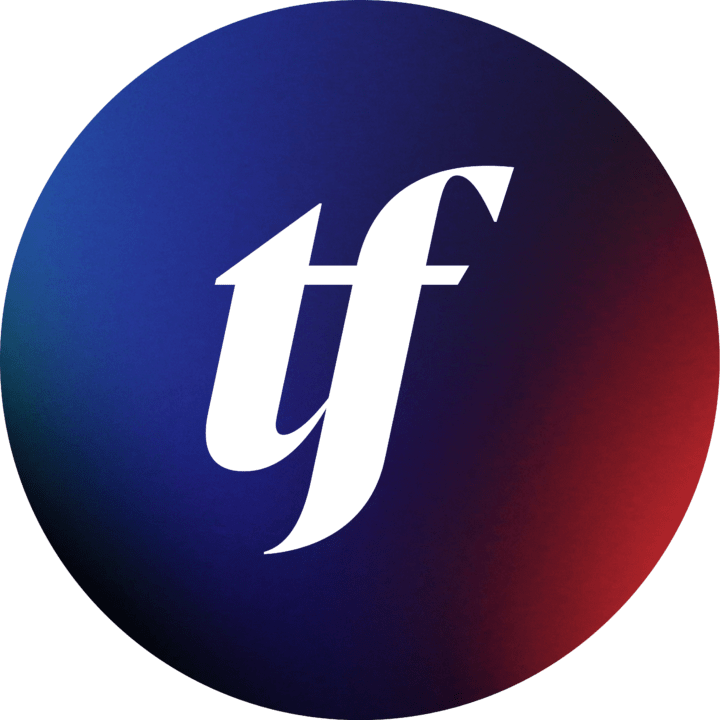Ob der Blockupy-Bewegung, Anti-TTIP-Demonstrant*innen oder Aktivist*innen, die sich gegen fossilen Kapitalismus einsetzten: Ihnen allen wird oft vorgehalten, zu viel dagegen zu sein und zu wenig positive Ansätze zu haben. Auch dem „Wutbürger“ wird z.B. von SZ-Autor Gerhard Matzig vorgeworfen, er sei nostalgisch, beschwöre das Alte, stelle sich immer einfach nur quer und sei zukunftsfeindlich.
Neulich am Küchentisch sah ich mich ebenfalls in der Situation, mein „Dagegen-Sein“ bezüglich klimaschädlicher Braunkohle-Verstromung rechtfertigen zu müssen mit einem Masterplan für eine CO2-neutrale Energieversorgung Deutschlands. Am besten inklusive ausgearbeiteter Schritte für den Weg dahin. Und ich fragte mich: Warum hat das „Dagegen-Sein“ eigentlich einen so schlechten Ruf? Warum braucht es immer gleich Antworten?
Klar. Mit einfach nur anti-sein kommen wir meist nicht weiter. Das zeigt sich z.B. im Zulauf der AfD, die gegen Schutzsuchende Menschen und für nicht gerade vor Positivität sprühende Zäune an den europäischen Außengrenzen ist. Auf deren Art will ich nicht dagegen sein. Gibt es vielleicht unterschiedliche Arten des Dagegen-Seins? Eine aus Angst vor dem Neuen, eine aus Wunsch nach dem Neuen? Ok, ich merk schon. Wunsch nach Neuem ist wieder so positiv und klingt nach Utopie und Revolution. Ich bin auch nicht gegen das Dafür-sein. Ich möchte nur auch gegen Dinge sein dürfen, die ich falsch finde, ohne gleich eine Lösung parat zu haben.
Schwammiges Gegen-Alles-Sein bringt (leider?) also nicht viel. Es hat keine Adressaten, bewirkt keine Veränderung – das kann ziemlich deprimierend sein. Deshalb ist es für das eigene Gefühl wichtig, seinem Dagegen-Sein über die komfortable Runde beim Abendessen hinaus Ausdruck zu verleihen. Für manche mag das beste Ventil für die Wut z.B. auf ausbeuterische Lebensmittelproduktion der Aufbau einer Solidarischen Landwirtschaft sein. Und es ist gut und wichtig, dass das so ist. Genauso gut und wichtig ist es aber, wenn die Wut in Protest und Ungehorsam mündet, der auf Missstände aufmerksam macht und einen Diskurs anstößt. Um nicht nur „das Gute“ aufzubauen, sondern auch „das Schlechte“, oder besser Gestrige, abzubauen.
Dazu hilft es wenig, sich darauf zu konzentrieren, was auf den ersten Blick besser geworden ist. Denn Discounter werden nicht auf einmal nachhaltiger, nur weil sie auch Bioprodukte anbieten. Stromkonzerne werden nicht „grün“, weil sie auch Windräder haben, so wie McDonald’s nicht mit einem grünen Logo und Salat im Angebot zu einem Slowfood-Restaurant mit Postwachstumsengagement geworden ist.
Es bleiben profitorientierte Konzerne, deren oberstes Interesse es ist, ihre Vorjahresbilanz zu übertreffen. Sie werden nicht zu humanistischen Akteuren, nur weil sie mit neuen Produkten auf gesellschaftliche Konsum-Umorientierung eingehen, um daran zu verdienen. Sie orientieren sich dabei auch an aufkommenden Nischen einer sozialen Avantgarde, die in bester Absicht auf dem Hausdach Gemüse zieht, Fahrrad statt Auto fährt und campen geht, statt pauschal zu reisen. Sie orientieren sich an Stil und Codes, kopieren diese und schwächen damit echte Alternativen.
Warum eine Solidarische Landwirtschaft aufbauen, wenn es beim Discounter Bio-Produkte gibt – in bequemer, billiger und ungebundener. Würden mehr Menschen sich für ganzheitliche Alternativen einsetzen, wenn dem allgemeinen Bedürfnis, ein bisschen was für sich, die Umwelt, das Klima zu tun, mit einer Konsumantwort seitens der Konzerne begegnet würde? Beschwichtigen sie damit nicht die Wut, die in uns aufkocht, wenn mal wieder neue Fakten über ausgebeutete Menschen und Tiere und zerstörte Natur für mehr Profit ans Licht kommen? Schläfern die kapitalistischen „Pseudo“-Lösungen unsere Wut ein?
Genau deshalb ist es wichtig, neben dem Aufbau von alternativen Lebens- und Wirtschaftsformen auch einfach mal dagegen zu sein, sich für das Dagegen einzusetzen. Nur das Positive würde vom Kapitalismus gefressen, nur das Dagegen würde uns selbst zerfressen. Wir brauchen beides. Dabei ist es jedoch ziemlich viel verlangt, zu erwarten, dass diejenigen, die Bäume besetzen, um RWE und Vattenfall am Weiterbaggern von Braunkohle zu hindern, gleichzeitig eine genossenschaftlich organisierte, regionale Energieversorgung aufbauen.
Was beispielsweise über die Gegner*innen von Vattenfall und RWE selten berichtet wird, ist, dass in der Organisation des Protests und im Miteinander der Aktivist*innen schon ein Dafür steckt. So werden auf Klimacamps auch subtile Hierarchien die im Umgang zwischen Menschen auftreten, hinterfragt, und es wird Raum für das Äußern von Bedürfnissen gegeben, die in der „normalen“ Gesellschaft keinen Platz haben.
In jedem Dagegen steckt ein Dafür
Die Frage ist nur – wofür. Ein utopisches Dafür, dass den meisten Menschen zu schwammig ist, weshalb sie es im Dagegen nicht erkennen. Es ist wichtig, dass wir lernen, uns auch auf ein unklareres Dafür einzulassen. Denn auch wenn wir nicht wissen (können), wie eine gerechte Versorgung aller Menschen mit Nahrung, Energie, Wohnraum und Gebrauchsgütern im Detail funktioniert, ist es wichtig, Ungerechtigkeiten anzuprangern.
Wenn wir es ehrlich betrachten, zeigen diese nämlich, dass es so wie es ist, auch nicht funktioniert. Der einzige Grund, warum wir es akzeptieren, ist, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und weil es – in vielen Fällen – schon mal schlimmer war. Aber das sollten keine Gründe sein, so zu tun, als wäre es schon gut. Deshalb brauchen wir das Dagegen-Sein. Oder um es mit Martin Luther King zu sagen:
„Ich bin überzeugt, dass es ebenso sehr unsere moralische Pflicht ist, dem Bösen unsere Gefolgschaft zu verweigern, wie sie dem Guten anzutragen.“
Bild: CC0, Kristopher Allison (unsplash)