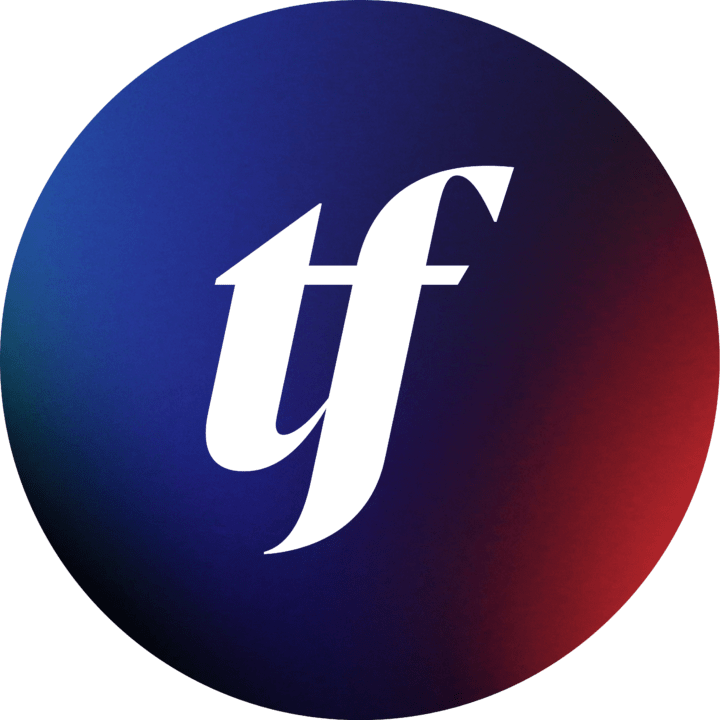Um Political Correctness wird schon lange gestritten. Um angebliche Privilegien und Diskriminierung in letzter Zeit noch mehr. Mit derlei “identitätspolitischen” Diskussionen kommen auch linke Szenen oft nicht mehr mit. Ist das ein progressiver Kulturkampf – oder ein gesellschaftlicher Rückschritt? Über die Frage, wer sich empören darf.
Was ist los mit diesen linken Leuten, die sich ständig untereinander streiten müssen? Jetzt können die sich nicht einmal mehr einigen, wer wann wozu was sagen darf. Weiße Mittelklasse-Feministinnen streiten sich mit selbsternannten Hip-Hop-Bitches über das Kopftuch, und bekommen gleichzeitig von nichtweißen Personen, die selbiges tragen, eins über die Rübe gezogen, weil mal wieder in ihrem Namen gesprochen wird.
Auf Festivals laufen weiße Menschen herum, die mehr Federn auf dem Kopf tragen als Winnetou, und sind erstaunt zu erfahren, dass andere ihr lustiges Faschingskostüm als „kulturelle Aneignung“ kritisieren.
Und selbst die progressivsten Linken verstehen keinen Spaß mehr, wenn ihre seligen Kindheitserinnerungen angekratzt werden, und sind bereit, „Pippi Langstrumpf“ bis aufs Blut als „Negerprinzessin“ zu verteidigen. Wenn gestritten wird, wer für wen spricht, wer sich wessen Symbole aneignet, wer überhaupt sprechen darf und worüber, heißt das „Identitätspolitik“. Oft sind es linke Leute, die sich darüber streiten. Aber geht es hier überhaupt um linke Themen?
Klassische Identitätspolitik: Die klassische Linke kennen wir eher im Beharren auf den Hauptwiderspruch und beim Gründen eines Arbeitskreises. Die Arbeiterklasse sollte an die Stelle des Subjekts, des Souveräns, treten und sich ermächtigen. Feministische Themen galten als Nebenwiderspruch und auch antirassistische Themen wurden der Klassenfrage untergeordnet. Darum kommt die klassische, marxistische Linke mit Identitätspolitik nicht so gut klar. Ihr geht es schließlich darum, dass eine marginalisierte Gruppe das Motiv des Klassenkampfs aufgreift, ihn jedoch auf sich selbst anwendet und dazu eine Identität für sich als Gruppe entwickelt.
Oft geschieht das, indem die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe als eine körperliche Gegebenheit angesehen wird,etwa Frau-Sein oder Schwarz-Sein. Die körperlichen Eigenschaften, an die der feministische oder antirassistische Kampf gebunden ist, wurden dabei gerne romantisiert und überhöht.
Dafür sind solche Konstruktionen von Identität immer wieder als „Essentialismus“ kritisiert worden, etwa von der US-Philosophin Judith Butler. Denn wenn Identitätspolitik so läuft, führt sie wiederum zum Ausschluss von Personen, die aus etablierten Kategorien herausfallen, wie Transgender. Die werden ohnehin von denen ausgeschlossen, die sich ganz selbstverständlich als „normal“ wahrnehmen. Linke Gruppen, die eigentlich für die Rechte der Marginalisierten streiten wollten, schließen sie dann ebenfalls aus.
Ein typisches Beispiel für solcherart romantisierte körperliche Eigenschaften ist die Mutterschaft, denn das Baby kann nun einmal, wie schon Monty Python in Das Leben des Brian satirisch auf den Punkt brachten, nicht in einer Zigarrenkiste aufbewahrt werden. Wer also zu einer unterdrückten, zu ermächtigenden Gruppe gehören und seine Identität darüber definieren möchte, sollte besser einen Uterus mitbringen.
Neue Identitätspolitik: Von Linken und Liberalen lernen. Kein Wunder also, dass Identitätspolitik in ihren ersten, essentialistischen Ausprägungen in linken Szenen schon immer auf Widerstand gestoßen ist. Auch die persönlichen Freiheiten wurden ja in klassisch linken Arbeitskämpfen meist als Nebenwiderspruch zurückgestellt. Vielmehr war es eine ganz andere politische Seite, die Emanzipation von Anfang an als individuelle Freiheit, Selbstbestimmung und Recht auf persönliche Entfaltung gedacht hat, nämlich die bürgerlichen Liberalen.
Allerdings hatte der liberale Vordenker John Locke, der dem freien Individuum einen Anspruch auf den „Besitz des eigenen Selbst“ zuschrieb, dabei den weißen Mann im Sinn, der über Besitz verfügte, und dessen Freiheiten nicht von staatlicher Seite eingeschränkt werden sollten. Der Mensch, der als normal gilt, ist bis heute in erster Linie der gesunde, mittelalte, weiße Mann.
In den USA, Mutterland der Identitätspolitik, haben sich inzwischen feministisches und antirassistisches Denken verbündet, um das Essentialismusproblem zu überwinden. „Intersektionalitätstheorie“ heißt das Zauberwort. Hier geht es nun gerade darum, zu kritisieren, dass Menschen jeweils einer Gruppe mit wesenhaften, gleichen Eigenschaften zugeteilt werden. Das brachte eine zweite Welle der Identitätspolitik mit sich, um die es geht, wenn Fragen verhandelt werden wie: Wer darf für wen sprechen? Wer darf welche Symbole verwenden? Wer darf bestimmen, ob in einer Situation Diskriminierung stattgefunden hat oder nicht? Wer hat die Deutungshoheit?
Diese neue Identitätspolitik hat vom Marxismus etwas Entscheidendes gelernt: Es gibt kein neutrales Individuum, alle haben ihre Geschichte, die zugleich eine Klassengeschichte ist. “Ich will keine Mittelklassewerte vermittelt bekommen!”, äußerte eine US-amerikanische studentische Aktivistin gegenüber der Zeitschrift New Yorker. Denn zu diesen Mittelklasse-Werten gehört auch die Idee, dass alle Subjekte gleich seien, weil alle dieselbe Vernunft haben. Individualistische Identitätspolitik streitet aber um Partizipation für alle, auch wenn sie nicht gleich sind und sich der Mittelklasse nicht anpassen.
Zugleich wird vom liberalen Denken die Wertschätzung der Freiheit des Individuums übernommen. Dieses Individuum hat nicht, wie bei Locke, nur Anspruch auf den Besitz des eigenen Selbst: Es soll zudem Anspruch haben auf eine ganz eigene Position, die sich nicht auf die Zugehörigkeit zu einer Klasse oder gar auf einen Körper reduziert, und auf die Artikulation der eigenen Befindlichkeit.
Du darfst jetzt mal nicht reden: Identitätspolitik ist ein Kampf um Ressourcen, und der beginnt mit symbolischen Ressourcen: Aufmerksamkeit, Redezeit und Definitionsmacht. Darum schließt die neue Identitätspolitik in der Praxis oft ein, „privilegierte“ Personen zum Schweigen, „diskriminierte“ hingegen zum Sprechen zu bringen. Schon für die antiautoritäre Linke klingt das, nun ja, schlicht autoritär. Bei denjenigen aber, die sich in erster Linie als Individuen in einem liberalen Sinn begreifen, stößt diese Art der Identitätspolitik auf den stärksten Widerstand.
Denn wer lässt sich weniger gerne einschränken als das liberale Individuum, dessen höchster Wert die persönliche Freiheit ist? Von dieser Seite wird diese am liebsten als Meinungsfreiheit verteidigt, gegen die sogenannte Political Correctness. Die sei unnatürlich, autoritär, moralisierend, und wolle verbieten, zu reden, wie man eben redet, und zu denken, was halt so normal ist zu denken. Dabei wird verstellt, dass auch und gerade das „normale“ Denken und Reden ein Diskursprodukt ist. Wäre es nicht veränderbar, würde es von den konservativen Wertebewahrern auch nicht so hitzig verteidigt. Und von all denen, die Veränderung zu mühsam finden.
Die erste Welle der Political Correctness in Deutschland sah so aus: Nein, das N-Wort soll nicht mehr benutzt werden, auch nicht das M-Wort, von niemandem, und nein, auch nicht für Gebäck, und ja, die Schaumküsse mögen euch albern vorkommen, aber trotzdem, und egal, wer es benutzt, es ist immer dasselbe Wort und nicht okay. Nein, auch als bayrischer Politiker fortgeschrittenen Alters soll man das Wort nicht benutzen, nein, auch nicht, wenn es nett gemeint ist. Nein.
Die zweite Welle, um die es jetzt geht, klingt eher so: Ich wurde in dieser Situation diskriminiert. Das ist eine Erfahrung, die ich artikuliere, um sie mir selbst und im zweiten Schritt auch dir verständlich zu machen. Nein, du kannst mir nicht sagen, dass ich nicht diskriminiert wurde, denn du hast das Privileg, nicht diskriminiert zu werden. Und darum kannst du das nicht beurteilen.
Therapeutischer Streit: Hast du gelernt, dich zu artikulieren?
Ist das nun sinnvoll oder doch nur autoritär? Erinnern wir uns kurz, worum es der Identitätspolitik geht: um die symbolischen Ressourcen. Es geht um das Hörbarmachen von Stimmen, die sonst nie gehört wurden – weil sie nur das sagen konnten, was die Norm ihnen als Worte in den Mund legte. Sich selbst als „Neger“ bezeichnen zu müssen? Wie fühlt sich das wohl an?
Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mich einfühle in eine Person, die eine solche Erfahrung artikulieren kann, steht mir völlig klar vor Augen, dass die individuelle Freiheit, die wir im Westen so sehr schätzen und preisen, nicht möglich ist, wenn Menschen in dieser Weise überfahren und überschrieben werden. Dafür überhaupt ein Gefühl bekommen zu können: Das ist eine aufklärerische Errungenschaft, die nur durch Identitätspolitik erreicht werden konnte.
Was also tun mit den Freaks, die uns ernst erklären, dass sie sich diskriminiert fühlen durch etwas, das uns in unserer Normalität als abwegig erscheint? Allem zustimmen aus Angst, als böse Privilegierte kritisiert zu werden? Sicher nicht. Alles wegboxen, was sie fordern, in der Gewissheit, privilegiert im Recht zu sein? Das war gestern. Wie wäre es mit einem ehrlichen Streit?
Es habe fast das ganze 20. Jahrhundert gedauert, bis die therapeutische Kultur des individuellen Sprechens über Emotionalität und die eigene Geschichte unser Selbst so geprägt hat, wie es jetzt der Fall ist, schreibt die Soziologin Eva Illouz. Nun ist es Zeit, eine echte Debattenkultur zu betreiben. Wir müssen streiten, so lange, bis die Praxis einer Artikulation von Befindlichkeiten im Mainstream angekommen ist.
Doch das kann nicht auf eine Weise funktionieren, wie es die IdentitätspolitikerInnen der Neuen Rechten fordern: dass alle im Namen der Meinungsfreiheit immer jedes Gefühl artikulieren dürfen, unabhängig davon, ob andere dabei verletzt werden.
Es geht um das „Wie“ dieser Artikulation, das eine Reflexion nicht nur auf die eigenen Grenzen und Erfahrungen, sondern auch die der anderen einschließen muss. Um eine Debattenkultur zu erlangen, bedarf es eines Austauschs zwischen mehreren Positionen, nicht des Aufeinandertreffens zementierter Festungen. Statt zu höhnen über die Befindlichkeiten anderer, deren Positionen wir noch nie auch nur versucht haben einzunehmen, sollten wir selbst lieber lernen, unsere Verletzbarkeit zu artikulieren, wenn wir kritisiert werden.
Die Begriffe kurz erklärt
Identitätspolitik
Der Kampf um Repräsentation und Ressourcen im Namen von Menschen, die als Gruppe davon ausgeschlossen werden. Feminismus und Schwarze Bewegungen betreiben sie seit den 60ern. Als Vordenker gelten u.a. Frantz Fanon (Die Verdammten dieser Erde, 1961) und Simone de Beauvoir (Das andere Geschlecht, 1949), die beide vom Existenzialismus und Marxismus beeinflusst wurden. Es geht in erster Linie darum, als Subjekte repräsentiert zu werden und die Geschichte jener zu schreiben und zu entdecken, die in der bisherigen Überlieferung aus machtpolitischen Gründen nicht dokumentiert wurden (Entkolonialisierung, „Herstory“).
Intersektionalitätstheorie
Ein identitätspolitischer Diskurs, der sich seit den späten 60ern aus Bewegungen schwarzer Feministinnen entwickelte. In den 80ern prägte die Juristin Kimberlé Crenshaw den Ausdruck für die arbeitsrechtliche Position schwarzer Frauen, die weder die „Privilegien“ (Peggy McIntosh) weißer Frauen, noch die schwarzer Männer genießen.
Die Theorie kritisiert die Konstruktion von Gruppen als das „Andere“ gegenüber der „Norm“, denn während die Norm wenig „markiert“ ist, ist das Andere nur über Markierung, also die Zuschreibung von Eigenschaften, fassbar. So war etwa „der Mensch“ lange eine Norm: der weiße Mann. Ging es um andere Menschen, musste das extra angemerkt werden. Wer mehreren Gruppen angehört, die als „anders“ konstruiert sind, erfährt „intersektional“ (Crenshaw) Diskriminierung. „Privilegiert“ hingegen sind Menschen, die relativ frei von der Zuschreibung solcher Gruppen sind.
Triggerwarnungen
Sich zu positionieren und die eigenen Befindlichkeiten zu artikulieren, kann auch bedeuten: Ich wage es zu sagen, wenn ich mich einer Diskussion oder einem Thema nicht aussetzen will. In „Triggerwarnungen“, also Warnhinweisen vor potentiell unangenehmen oder diskriminierenden Medieninhalten, sehen aber auch kluge UnterstützerInnen politischer Korrekturen eine Praxis der Verweichlichung. Welche Norm aber legt hier fest, was wir auszuhalten haben? Unsere Lebenswirklichkeit hat sich medial verändert. In dem Strom an Daten und Bildern, in dem wir leben, sind Mechanismen der Orientierung nicht unsinnig.
Triggerwarnungen bedeuten schließlich nicht Zensur oder Immunität von allem Unangenehmen, sondern die Möglichkeit zu entscheiden: Ich möchte das jetzt nicht sehen oder mich zumindest darauf einstellen können, was ich zu sehen bekomme. Die Haltung, wir müssten alle Bilder und Themen jederzeit aushalten, stärkt uns nicht, sondern stumpft uns ab, macht uns gleichgültig und intensiviert das Gefühl, in einem Strom von Ereignissen zu sein, die wir ohnehin nicht beeinflussen können.
Beitragsbild: CCO Levi Saunders
Dieser Artikel wurde in der dritten Ausgabe des transform Magazins gedruckt, welche du hier bestellen kannst. Ausgabe 2 & 3 im Kombipaket sind momentan 15% günstiger.