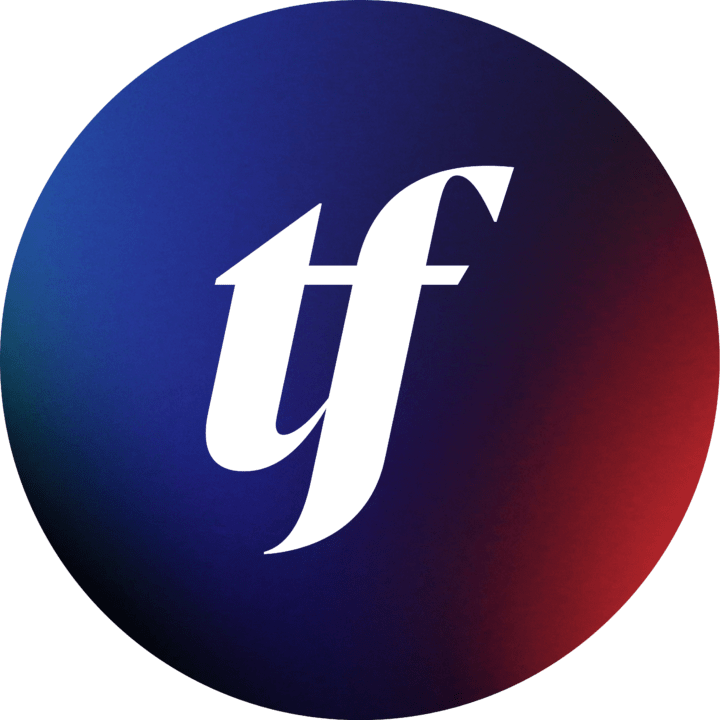Der neoliberale – hier verstanden als der marktliberale – Geist, diese Ansammlung verschiedenster Strömungen, die vor allem auf „Freiheit“ setzen, hat schon lange die Universitäten erfasst. Auch das Forschen und Lehren muss nach und nach marktfähig und vermarktbar werden. Mit Freiheit, einem der Grundprinzipien (wenn nicht dem Grundprinzip) des Neoliberalismus, hat dies inzwischen kaum mehr etwas zu tun: Paradoxerweise ist es gerade der Neoliberalismus, der beispielsweise zu einer Aufblähung der Verwaltung führt.
Über die Auswirkungen des Neoliberalismus an Universitäten könnten sicher ganze Bücher geschrieben werden, und viele Probleme wie Publikationsdruck und Kreditpunktejagd wurden schon häufig beklagt. Ich erzähle hier von einigen weniger bekannten Beispielen aus dem alltäglichen Kuriositätenkabinett, in denen uns die Grundprobleme des Neoliberalismus begegnen: mangelnde Vertrauensfähigkeit, Fokussierung auf den einsamen Spitzenreiter und die Institutionalisierung des Wettbewerbs.
Freudig produziere ich Klicks
Der Neoliberalismus hat vor allem ein Grundproblem: Er kann einfach nicht vertrauen. Alles muss gemessen, evaluiert und in konkreten Zahlen festgehalten werden – quantifizierbar, überprüfbar, berechenbar. Um dazu in der Lage zu sein, muss alles dokumentiert werden, am besten haarklein und bis ins Detail nachvollziehbar. Ein Beispiel dafür ist die Lehre: Wer heute studiert, klickt auch viel.
Man schafft teure Systeme an, die nicht nur jede Bewegung bei An- und Abmeldungen von Kursen oder Prüfungen und Benotungen genau festhalten. Nein: Diese Systeme versuchen häufig, die ganze Komplexität der Realität genau abzubilden, zum Beispiel indem vorher genau festgelegte Kurskombinationen oder Studierwege nur auf diese und jene Weise anklickbar sind.
Die Systeme werden dadurch nicht nur sehr komplex, sondern berauben Lehrende und Studierende vieler Freiheiten: Vorbei die Zeiten, in denen man eine Hausarbeit auch mal drei Wochen später abgeben konnte, weil man in den Ferien Post austragen musste oder in der örtlichen Kinderfreizeit freiwillig Dienst tat. Leichter war es auch schonmal, jemandem unkompliziert eine Sondergenehmigung erteilen, zwei sonst nicht miteinander kombinierbare Kurse parallel zu belegen, weil der oder die Studierende eine besondere Vorgeschichte mitbrachte. Und wie schön war es noch, als man sich ohne Klickorgie ein Seminar in Ruhe zwei Wochen lang anschauen konnte, um dann zu entscheiden, ob es das richtige für einen war. Das System aus Kreditpunkten, Leistungsnachweisen und recht eng gestrickten Verlaufsplänen ist hier unerbittlich – oft durch die entsprechende Software im Hintergrund unterstützt: Was einst die Dinge einfacher machen sollte, knechtet uns nun.
Die Frage ist natürlich, ob man in die Zeit zurück will, als Studierende mit Stolz berichteten, sie seien nun im 25. Semester endlich zur Zwischenprüfung angemeldet, und ja, nicht zu Unrecht wird oft argumentiert, dass feste Abgabefristen eine Frage der Gerechtigkeit sind. Aber: Manch 4-jähriger kann schon ohne Stützrad fahren, andere nicht. Würden wir hier mit Gerechtigkeit argumentieren, würden wir des Pudels Kern nicht treffen. Ja, es muss bestimmte Prinzipien geben, die auch nicht ohne Ende gebeugt werden können, man muss aber wieder mehr Vertrauen in die Lehrenden (und Studierenden!) und deren Ziele setzen.
Wieviel Qualitätsmanagement, Controlling, Evaluation etc. man auch immer betreibt: In vielerlei Hinsicht wird Lehre dadurch nicht besser. Verbessern kann man sie eher durch entsprechende Unterstützungsangebote für Lehrende, insbesondere diejenigen, die zwar mit guten wissenschaftlichen, aber kaum pädagogischen Qualifikationen an der Universität lehren. Alle, die sich von Evaluation und harten Regeln die große Neuerfindung der Lehre erträumen, tun so, als sei die Lehre der letzten Jahrzehnte an Universitäten für die Katz gewesen – und das hohe technische, wirtschaftliche und kulturelle Niveau Deutschlands ein Zufallsprodukt.
Er zog sie alle mit
„Leistung muss sich lohnen“, schallt es immer wieder aus verschiedensten Parteiorganen. Der Neoliberalismus hat mit dem Leistungsprinzip einen erkennbaren Markenkern. Er hat damit aber auch ein Problem: Oft wird damit die Figur des Leistungsträgers verbunden (zudem gerne männlich, dies ist aber ein anderes Problem).
An der Universität sind Leistungsträger insbesondere eines: „Univ.-Prof.“. Diese sind es, die ihr Gehalt oft frei verhandeln und Leistungszulagen verlangen können. Sind sie daher die einzigen, die Leistung bringen? Mitnichten. Es gibt eine ganze Phalanx an außerplanmäßigen und Juniorprofessuren, Privatdozenten, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Lehrkräften, die häufig die Aufgabe übernehmen, den Kernbetrieb aufrecht zu erhalten. Leistungszulagen für besondere Lehr- und Forschungsleistungen sind dabei eher Fehlanzeige.
Noch skurriler wird dies, wenn man sich vor Augen führt, dass es in Deutschland kein echtes Aufstiegssystem gibt. Während in anderen Ländern der- oder diejenige zum „ordentlichen Professor“ (d.h. Professor mit allen Rechten und Pflichten sowie entsprechender Ausstattung) aufsteigt, der oder die besondere Leistungen erbringt, spielt in Deutschland der richtige Alterungsprozess eine besonders wichtige Rolle: Die Zahl der Professuren ist durch die jeweils vorhandenen Stellen festgelegt, es muss erst jemand die Professur verlassen (oft durch Pensionierung), bis diese wieder besetzt werden kann, alle anderen verharren im ziemlich entrechteten Mittelbau. Der Weg zur Professur (oder überhaupt Dauerstelle) ist steinig: Über 90% der wissenschaftlich Beschäftigten sitzen auf Ketten-Fristverträgen, oft kurz und nur auf Teilzeit, viele bleiben über Jahre darauf sitzen. Beides zusammengenommen, Leistungszulagen nur für die Spitze der Personalpyramide sowie die Tatsache, dass diese Spitzenposition eher durch Zufälle (richtiges Alter zum Berufungszeitpunkt, Verfügbarkeit einer Stelle etc.) zugewiesen wird, führen das Bild des Leistungsträgers ad absurdum.
Wettbewerb der Ideen?
Ein anderes Kernmerkmal des Neoliberalismus ist der Wettbewerb: Und tatsächlich mag man glauben, dass das alte Prinzip des Wettbewerbs der Ideen in der Wissenschaft wie auch im marktliberalen Modell gut miteinander einhergehen sollten. Das Problem aber sind die Mittel, mit denen dieser Wettbewerb erreicht werden soll.
Wissenschaft ist nichts für Sprinter: Ideen werden erst nach und nach entwickelt und aufgebaut, dem „Markt“, also der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, immer wieder präsentiert und durch Diskurs und Gegenprobe getestet. Dazu braucht es die entsprechende Grundfinanzierung. Heute steht die Idee erst am Anfang eines lange andauernden Geldeinwerbeprozesses: Forschung muss, will sie finanziert werden, beantragt werden, und zwar mit einem recht eindeutigen Plan, der, meist auf ca. 3 Jahre begrenzt, genauestens darstellt, welches Problem mit welchen Lösungen angegangen werden soll. Der Verdacht einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung liegt häufig nahe. Und: Wer im Anschluss an eine als förderwürdig erachtete Idee gerne eine weitere produzieren möchte, sollte besser nicht scheitern.
Scheitern gehört zur Forschung allerdings genauso dazu wie Erfolg. Würden Universitäten und andere Einrichtungen diese Risiken nicht auf sich nehmen, hätte die Wirtschaft nichts zu vermarkten, die Kunst nichts zu diskutieren und die Industrie nichts zu produzieren: Die sich oft selbst als innovativ lobenden Konzerne sind, wie Mariana Mazzucato in ihrem Buch “Das Kapital des Staates” feststellt, oft nicht gewillt, diese Risiken auf sich zu nehmen und lagern diese auf den Staat aus. Viele erfolgreichst vermarktete Ideen wurden zuerst an Universitäten und anderen öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen entwickelt.
Wenn sich nun auch der Staat dem Risiko des Scheiterns entziehen will, greift er tief in die Freiheit jedweder Forschung ein: Hat die Gesellschaft einerseits ein Recht darauf, über Forschung und ihren Zweck informiert zu werden und mitzuentscheiden, führt andererseits ein zu enges Korsett dazu, dass Grundlagenforschung dahinsiecht und angewandte Forschung wenig risikofreudig wird.
Ein weiteres Paradoxon gesellt sich hinzu: Um Ideen bestens zu vermarkten, werden an Universitäten zunehmend Stabstellen und außerhalb davon Agenturen gegründet, die dabei helfen sollen, den Antrag auf Finanzierung möglichst aufzupolieren, aufzupeppeln, marktgängig zu machen. Inwiefern die Forschungsidee dabei im Vordergrund steht, muss sicher im Einzelfall beurteilt werden. Bizarr ist in meinen Augen aber, dass dadurch große Apparate rund um die Forschung aufgebaut werden, die auch finanziert werden wollen – nicht zuletzt stellt sich mir immer wieder die Frage, wer eigentlich am Ende konkurriert, die Wissenschaftler oder diese Stabsstellen und Agenturen. Und die Frage, ob man nicht zumindest einige der Wissenschaftler, die darin beschäftigt werden, nicht besser für Forschung und Lehre bezahlt hätte.
Der Neoliberalismus muss zu etwas Neuem werden
Es ist zum Haareraufen: Mit guten Absichten angetreten, hat der Neoliberalismus teils das Gegenteil erreicht. Der neoliberale Geist muss einen Schritt zurück tun und sich die Resultate der Wissenschaftspolitik der letzten Jahre anschauen – und was davon er eigentlich wollte und was nicht. Während einige Prinzipien wie das Leistungsprinzip nicht konsequent durchdacht wurden, sind andere Entwicklungen wie die ständige Produktion von Maßzahlen sicher nicht das, was dem eigentlichen Geist der Freiheit entspricht. Der Neoliberalismus an den Universitäten wird sich verändern müssen, und am Ende sicher nicht mehr das sein, was er jetzt ist. Ein neuer Name allein macht aber keine neuen Inhalte.
Was vom Neoliberalismus übrig blieb
Hat denn das neoliberale Experiment an den Universitäten auch etwas Gutes hervorgebracht? Etwas zähneknirschend muss ich gestehen: ja, durchaus. Der Neoliberalismus hat die vorher schon von der sozialen Aufstiegsbewegung entwickelte Idee aufgegriffen, dass es Leistung und nicht Herkunft oder Status ist, die uns definiert und nach der wir bemessen werden sollen. Dass aber zuviel gemessen (und oft mehr gefordert und gefördert) wird, ist ein Problem. Außerdem hat der Neoliberalismus einiges von dem Mief vertrieben, der sich unter anderem in den Verwaltungen festgesetzt hatte. Auch wenn ich den Ausdruck „dienstleistungsorientiert“ nicht besonders schätze, da ich in niemandem meinen Diener sehe, so begrüße ich die zunehmende Geisteshaltung sehr, dass die Verwaltung Wissenschaftler in ihren Aufgaben nicht aus einem falschen Torwächterverständnis heraus behindern, sondern diese unterstützen soll.
Diese Errungenschaften des Neoliberalismus beizubehalten und die Fehlentwicklungen zu korrigieren, wird eine Aufgabe sein, die die Universitäten nur in eine bessere Zukunft führen können.
Beitragsbild: CC-BY 2.0, “Books at The Hague Center” von Pascal Maramis