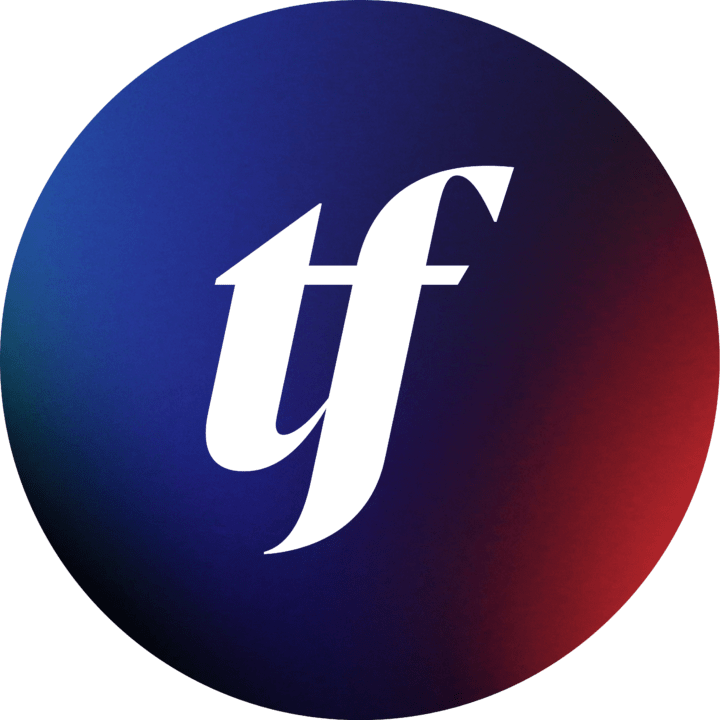Sparen wir wirklich Zeit durch Apps und Gadgets? Oder verlieren wir nicht etwas Wundervolles? Eine Anekote.
Neulich hatte ich Besuch von Google. Ich arbeitete im Café, als ein Mann aus dem nachmittäglichen Herbstdunkel das Treppchen zur Eingangstür hinaufstieg; den Blick gesenkt, auf ein tragbares Display starrend. Erst als er sicher schien, dass er sich an den Koordinaten des Ortes befand, an den er zu kommen geplant hatte, hob er den Kopf und kam herein. Er stellte sich freundlich vor, er käme von Google. Ich hatte mir Menschen, die bei diesem Konzern arbeiten, immer ein wenig vorgestellt wie die grauen Herren bei Momo. Dieser Googleist sah nett und ziemlich normal aus. Bis auf das surreale Gefühl, das seine Aussage in mir hervorrief, war er von anderen Menschen nur dadurch zu unterscheiden, dass seine linke Hand à la Cyborg durch die offenbar permanente Anbringung eines iPads optimiert worden war. Aber so richtig besonders ist das dieser Zeiten ja auch nicht mehr.
Der große Bruder sprach von Google Business Photos, einem Service, der Geschäftsinhabern angeboten wird, um ihre Internetpräsenz zu verbessern. Der Geschäftsraum würde abgelichtet, um Google Streetview nach innen auszudehnen. Damit für Kunden schon vorab einsehbar sei, ob es hier im Detail ihrem Geschmack entspricht und sie einen Besuch wagen können. Google schenkt uns also in Zukunft ein neues Tool, mit dem wir unsere Ausflüge noch effizienter planen können. Wir müssen uns nicht mehr auf etwas einlassen, bei dem wir zumindest optisch nicht davon ausgehen können, dass es zu 100% unseren Vorstellungen entspricht. Wir müssen uns nicht mit Menschen austauschen, sie nach ihrer Meinung oder Empfehlung fragen. Wir entnehmen alle Information dem Bild. Einfach und praktisch.
Doch etwas daran ist mir unheimlich: Die zwischenmenschliche Interaktion wird wegrationalisiert. Stattdessen geben wir noch mehr Macht den Bildern. Dem Schein. Dem Look.
Der Glaube ans Gute im Menschen
Ich bin eine Freundin des Internets. Es eröffnet unzählige Möglichkeiten zu lernen, sich zu vernetzen. Aber dieses blinde Vertrauen in digitale Bequemlichkeit beunruhigt mich. Denn ich bin auch eine Freundin des Zufalls und von zwecksneurosenbefreiten Begegnungen, die er hervorbringen kann. Zufällige Begegnungen mit unbekannten Menschen haben mein Wissen darüber, dass der Mensch ein gutes Wesen ist, gefestigt. Sie haben mich wundern lassen, über die verschiedenen Denk- und Lebensarten, die aber doch einiges gemeinsam haben und friedlich nebeneinander und miteinander existieren können.
Viele dieser Begegnungen, die mich und mein Denken ausmachen, hätten womöglich nicht stattgefunden, wenn es Google Streetview schon in diesem ausgedehnten Maße gegeben hätte und sowohl ich als auch die mir Begegneten es genutzt hätten. Wir hätten in unseren Zimmern gesessen und online nach den gewünschten Informationen gesucht. Die Straße wäre leer geworden. Wer sie heute beträte, täte dies mit einem Ziel vor Augen, von dem er sicher sein müsste, dass es die große Anstrengung wert ist, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich in den öffentlichen Raum zu begeben, in dem wir uns reiben und hinterfragen.
Dabei setzt das Ziel im Kopf uns Scheuklappen auf, die die Lebenswelten anderer verschwinden lassen. Und unser Menschenbild konstituiert sich nur noch aus den Zusammenkünften mit Menschen, die meist in derselben Milieusuppe schwimmen wie wir selbst. Und aus Nachrichten, in denen immer wieder an unsere Mattscheibe geklatscht wird, wie gefährlich andere Menschen doch seien. Vielleicht ist das mein Problem mit diesem zufallsfeindlichen Werkzeug. Es hebelt die Funktion des öffentlichen Raumes, ein Ort der heterogenen Begegnungen zu sein, aus. Ein Ort, an dem wir lernen würden, dass der Mensch kein Wesen ist, vor dem es sich zu fürchten gilt. Um nicht Getriebene von Ängsten und Befürchtungen zu werden, müssen wir Menschen begegnen. Einfach so. Zufällig und ohne Hintergedanken. So können wir Vertrauen lernen. Und der sicherheitsbedürftigen Bürgerschaft wäre die Grundlage für eine heimliche Zustimmung zu beklemmender Überwachung entzogen.
Mit den praktischen Instrumenten aus dem Silicon Valley erziehen wir uns systematisch den Zufall ab. Und was nicht unseren digital basierten Erwartungen entspricht, wird schnell negativ empfunden. Habe ich über Google Streetview einen Blick in die Kuchentheke eines Cafés geworfen und bin dorthin aufgebrochen mit dem festen Vorhaben, die angepriesene Blaubeertorte zu vernaschen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich enttäuscht bin, wenn es an ihrer statt Schoko-Karamell-Streusel gibt. Und so wie wir den Ereignissen ihre Autonomie absprechen und versuchen, alles der perfekten Planung und einem Zweck zu unterwerfen, neigen wir auch den Menschen zu begegnen. Vielleicht weil es kein Google Brainview oder Google Heartview gibt, das uns Sicherheit darüber geben könnte, worauf wir uns einlassen, wenn wir uns mit anderen Menschen umgeben. Zeigt sich in Google X-view die Sehnsucht nach Berechenbarkeit und das Bedürfnis nach Sicherheit? Oder steigern die Onlinedienste genau diese unspontanen Angstvariationen, indem wir uns von ihnen zur Bequemlichkeit erziehen lassen? Was auch immer der Anfang war: Immer neue Dienste werden immer neue Sicherheiten suggerieren, die uns immer ängstlicher machen.
Der Sinn des Zwecklosen
Warum diese Angst vor dem Zufall, wenn wir ihm nicht nur viele Entdeckungen, sondern den zufälligen Mutationen der Evolution sogar unsere Existenz verdanken? Die Offenheit gegenüber dem Zufall öffnet uns Türen, die dem geplanten Geist nicht nur verschlossen, sondern nicht einmal existent erscheinen. Eine Frau, die ihren Ehemann nur zweckmäßig als Ernährer und Freizeitgefährte sieht, wird niemals in die Tiefen des gemeinsamen Glücks vordringen, einander durch zufällige Geistesregungen zu inspirieren. Wer dem Zufall gegenüber offen ist, kann erfahren, dass sich Zweckloses durchaus sinnvoll anfühlen kann. Diese Wahrnehmungserfahrung ließe sich auf vieles übertragen, das wir dann nicht mehr durch die ökonomische Brille bewerten würden.
Da aber auf den Zufall kein Verlass ist, könnte, wer sich ihm hingibt, auch der Langeweile begegnen. Sie ist unproduktiv und gefürchtet. Wer sie trifft, begegnet der nackten Zeit – und sich selbst. Wer die Angst davor überwindet, schafft Raum für Neues. Neues, das zufällig aus den sich in der Leere kreuzenden Erinnerungen entsteht. Neues, das Antrieb und Inhalt von Leben und Gesellschaft sein kann, und damit nicht nur Sinn, sondern sogar auch wieder Zweck hätte. Und selbst wenn nicht, ist es oft wunderbar und voller Staunen.
Wer es schafft, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und zwischendurch mal, wider allen Optimierungswahn unserer Zeit, dem Zufall freie Hand zu lassen, wird auch dem Menschen optimistischer und vertrauensvoller begegnen.
Google, Facebook und Co. werden nicht aufhören, uns Angebote zu unterbreiten, die uns das Leben so einfach und bequem machen, dass wir sie kaum ausschlagen können. Doch gezwungen sie zu nutzen, sind wir nicht.